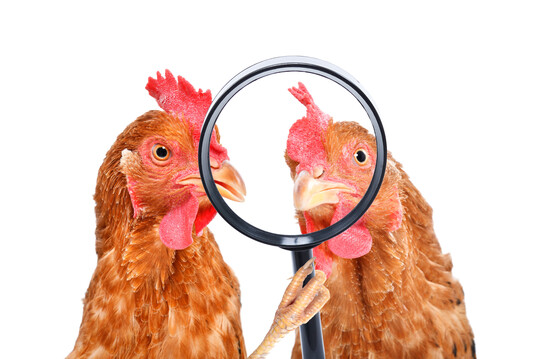Wer ist schuld an guter Leistung?
Mitte März 2023 trafen sich über 120 Wissenschaftler und Firmenvertreter der Geflügelbranche, um sich der Schuldfrage guter Leistungen und derer Herausforderungen zu widmen. Tiergesundheit, Zucht oder Fütterung - welcher Bereich hat den größten Einfluss, wenn es um eine tiergerechte Haltung von Legehennen und Mastgeflügel geht?
- Veröffentlicht am
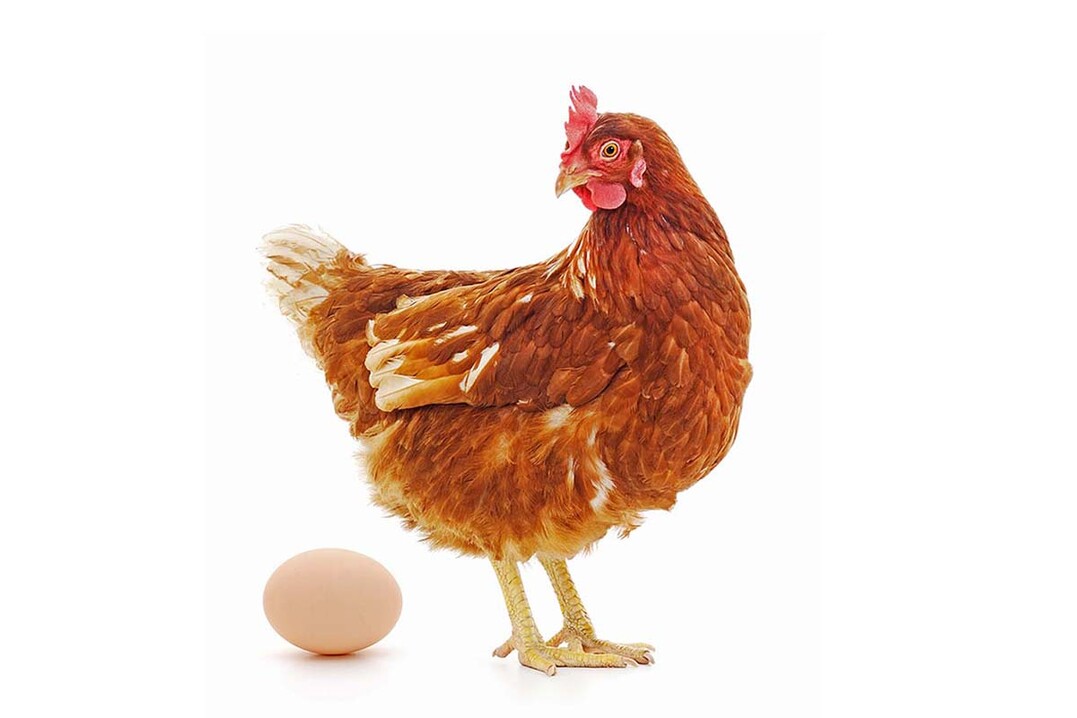
Ein voller Hörsaal in der Klinik für Pferde an der FU Berlin – zu hören sind aber Vorträge zu aktuellen Geflügelthemen. Kein Versehen, sondern ein großartiger Platz für die diesjährige Frühjahrsveranstaltung der Deutschen Vereinigung für Geflügelwissenschaft e.V. Über 120 Wissenschaftler und Mitglieder diskutierten Forschungsergebnisse zu mehr Tierwohl und kosteneffizienter Geflügelhaltung.
Tierwohl – kein Widerspruch zur Leistungszucht
Nach einem Grußwort von Dr. Michael Grashorn, dem Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Geflügelwissenschaft e. V., erklärte Dr. Matthias Schmutz von den Lohmann Breeders, dass Leistung und Tierwohl in der Legehennenhaltung nicht im Widerspruch stünden. Leider mussten große Teile der professionellen Geflügelzucht aus Deutschland ausgelagert werden, da seit dem Verbot der Einzelkäfige keine genaue Datenerfassung mehr durchführbar sei. Wichtige Merkmale, wie die Futteraufnahme, die Eiqualität oder auch die Schlupffähigkeit könnten nur in diesem Haltungssystem wissenschaftlich fundiert geprüft werden. Da auch die Gruppenkäfige keine langen Laufzeiten mehr hätten, würden diese Testverfahren sogar teils in außereuropäisches Ausland verlagert. Geblieben sind die Transpondernester, in denen hauptsächlich die Nestgängigkeit, die Befiederung und die Mortalität untersucht würden.
Dem allgemeinen Vorwurf, warum nicht auf Alternativhaltung gezüchtet werde, kann Schmutz nicht folgen. Legehennen, die nach dem bekannten Selektionsindex selektiert würden, könnten jederzeit auch in alternativen Haltungsformen bestehen. Grundsätzlich sei klar, dass nicht alle Merkmale gleichzeitig verbessert werden können. Wer nur auf Robustheit selektiere, werde zwar eine schöne Befiederung der Tiere erreichen. Gleichzeitig würden aber auch starke Leistungseinbußen und hohe Futterverbräuche gefördert. In einem Vergleich von Selektionsszenarien zeigte der Genetiker auf, wie trotz negativer Korrelation von Merkmalen, ein Zuchtfortschritt für alle erreicht werde – schließlich sei dies das „tägliche Geschäft“ der Zuchtexperten. In einer ausgeglichenen Zuchtstrategie bleibe die Eizahl im mittleren und großen Eigewichtssegment das wichtigste Merkmal, dafür wurden aber Merkmale wie Robustheit/ Mortalität oder Befiederung ebenfalls stärker gewichtet.
Frühreif – nur mit genügend Futter
Weiter erklärte Schmutz, dass sich negative Effekte von frühreifen Hennen in Praxisdaten nicht eindeutig bestätigen ließen. Was allerdings ein bestätigter Fakt sei: Die Mortalität steige mit zunehmendem Eigewicht an. Brustbeinfrakturen bei den Legehennen seien ein Indiz für eine frühe und hohe Legeleistung, das Eigewicht aber habe an dieser Stelle weniger damit zu tun. Eine hohe Legespitze ist laut Schmutz in erster Linie ein Zeichen für ein gutes Management in der Aufzucht und zu Legebeginn. Sehr wichtig sei, dass die Tiere dabei kein Körpergewicht verlieren, weshalb sie eine leistungsgerechte Ernährung benötigen. Auch die Futteraufnahme(-Kapazität) sei kein begrenzender Faktor, denn „Hühner können genug fressen. Sollte das nicht der Fall sein, haben sie zu wenig Platz oder nicht schmeckendes Futter“, argumentierte der erfahrene Wissenschaftler.
Fütterung – Qualität bei jedem Preis
Bei dem Stichwort „genug fressen“ übernahm Robert Pottgüter, der Spezialist in allen Fragen rund um die Legehennenfütterung, und beschrieb deren Herausforderungen vor dem Hintergrund hoher Rohstoffpreise. Seit dem 24. Februar 2022 sei die Welt eine andere geworden, so der Fütterungsexperte. Der Wettbewerb um Rohstoffe und Futtermittel sei härter geworden und die Preise stiegen an. Im vergangenen Jahr erreichten die Weizenpreise nahezu 430 €/t, Non-GVO-Soja kostete weit über 1.000 €/t - wenn es überhaupt verfügbar war. Auch die Versorgung mit Futterzusatzstoffen wie Lysin ergab Probleme und Phosphate seien ebenfalls knapp und teuer. Unter diesen Voraussetzungen stieg der Vorteil von eigenem Getreide und Eigenmischungen an, allerdings nur, wenn es fachkundig verwendet würde.
Zwar sinken seit November 2022 die Weizenpreise kontinuierlich und auch die Sojapreise fielen wieder, folgten sie doch stets den Rohölpreisen. Doch genauso schnell könnte wieder eine Mangelsituation eintreten, mahnte Pottgüter, ob durch Dürreperioden oder über die Macht der WASDE-Berichte des USDA. Was also tun, um auf Krisensituationen vorbereitet zu sein? Ein wichtiger Punkt sei die völlig „emotionsfreie“ Fütterung, erklärte der Spezialist. Die Rohstoffauswahl müsse ohne Vorbehalte getroffen werden und konsequent nur auf die Erfüllung des Nährstoffbedarfs der Tiere eingestellt sein. „Warum also gibt es immer noch so viele Vorbehalte gegen Rapsprodukte?“, fragte der Wissenschaftler ins Publikum.
Futterzusätze – mehr Vertrauen in die Experten
Auch das Vertrauen in (neue) Futterzusatzstoffe müsse wachsen, kritisierte er. So gäbe es Enzyme mit sogenannten Energie-Uplifts. Diese könnten zwar nicht analytisch ermittelt werden, zeigten sich aber durchaus in der Praxis. Mit einem „Superdosing“ von Phytase (zwei- bis dreifache Dosierung) könnten hohe Preise für Monocalciumphosphat (MCP, wichtigste Phosphorquelle in Nutztierrationen) umgangen werden. Gerade auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit sei dies ein gutes Argument. Mit absolutem Unverständnis reagierte Pottgüter bei der Tatsache, dass Phytase für die Fütterung im Biobereich bis heute von den Verbänden nicht zugelassen sei. Selbst ein drängender Appell führender Wissenschaftler habe daran nichts bewirken können.
Als unerlässlich sieht der Tierernährer eine exakte Leistungs- und Datenerfassung in der Produktion an, um zu wissen, was Geld und Effekte, z.B. durch Zusatzstoffe wirklich bringen. Besser als nur auf die Futterkosten und den täglichen Futterverzehr zu schauen, sei es, eine definierte Eimasse je Zeiteinheit und die Futterverwertung zu ermitteln. So sei es möglich, mit einem „Split-Feeding“ Futterkosten zu reduzieren.
Picken – aber bitte nur im Futter
„Die Legehennenhaltung ist eine Gratwanderung“, mit diesen Worten beschrieb Dr. Sabine Gebhardt-Henrich vom Zentrum für tiergerechte Haltung der Universität Bern in der Schweiz die heutige Eiererzeugung. Die Herden könnten schnell abstürzen, wenn die Bedingungen nicht optimal seien. Die Biologin beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Zehenpicken und konnte den Zuhörern neueste Erkenntnisse aus ihrer Forschung vorstellen. Die starke Zunahme der Verhaltensanomalie in Schweizer Ställen in den vergangenen Jahren, scheint hauptsächlich bei weißen Hybriden aufzutreten. Daher sei ein genetischer Faktor klar vorhanden. Doch was sind weitere Ursachen für das Auftreten des Zehenpickens?
Eine Umfrage in Schweizer Geflügelhaltungen vor der experimentellen Studie ergab bereits, dass Faktoren wie ein E. coli-Befall, Metallroste, direkte Sonneneinstrahlung oder Hochfrequenzlampen ein drei- bis zehnfach höheres Risiko eines Ausbruchs darstellten. Als wirksamste Gegenmaßnahme stellte sich die Lichtreduktion heraus, aber auch mehr Beschäftigung und die Optimierung von Futter- und Wassergaben bzw. vom Stallklima konnten leichte Verbesserungen erreichen. Eine verringerte Besatzdichte half dagegen nicht. Im Nachgang startete Gebhardt-Henrich ein Experiment, in dem weiße Hennen durch den Wegfall einer Fütterung Stress induziert werden sollte. Allerdings induzieret der Wegfall kein Zehenpicken sondern brachte erstaunlicherweise mehr Ruhe und weniger Verletzungen zum Vorschein.
Weiterhin wurde beobachtet, dass sich Hennen mit verletzten Zehen deutlich anders im Volierensystem bewegen als gesunde Tiere. Verletzte Tiere veränderten ihr Bewegungsprofil über den Tag und blieben oft in den oberen Etagen. Obwohl das Zehenpicken von den Wissenschaftlern am häufigsten als sogenanntes Selbstpicken beobachtet wurde, müsse die positive Korrelation aus Zehen- und Kammpicken als ein eindeutiges Indiz für Fremdpicken gewertet werden. Generell habe das Zehenpicken mit dem Federpicken viel gemein, so sei es ein multifaktorielles Geschehen, das assoziiert mit Stressfaktoren wie Infektionsdruck verlaufe. Nur zeigten Herden mit Zehenpickern ein gutes Gefieder.
Von alten Erregern und neuen Verfahren
"I'll be back – Rückkehr altbekannter Geflügelpathogene", so titelte Dr. Andreas Bublat von der MSD Tiergesundheit seinen Vortrag. Er warnte vor steigenden Infektionszahlen mit Rotlauf, Schwarzkopf und SLD (spotty liver disease) in den Geflügelhaltungen. Durch die zunehmende Freilandhaltung und Resistenzen bei den Wurmmitteln stehe daher die Biosicherheit und Auslaufpflege bei der Bekämpfung der Vektoren für die Krankheitserreger im Vordergrund. Denn Medikamente gäbe es nicht bzw. sie seien nur bestandsspezifisch erhältlich.
Axel Schulz von der Fa. Big Dutchman stellte den Wärmetauscher „Earny“ vor, der nicht nur ca. 44 % an Kosten bei der Wärmerückgewinnung einsparen könne, sondern auch Emissionen aus dem Broilerstall reduziere. Je nach Gaspeis (4 bzw. 12 ct/kWh) würde der Break-Even-Point bereits nach 1,5 bzw. 4 Jahren nach Anschaffung erreicht sein. Das gleichzeitig reduzierte Treibhausgas Ammoniak (-29 %), die um ein Drittel gesunkene Geruchsemissionen und eine um gut ein Viertel verringerte Staubabscheidungen je Jahr sprechen ebenfalls für diese Technologie. Derzeit würden 550 Einheiten im Feld arbeiten, die Energiekrise habe den Verkauf stark angetrieben, so der Diplom-Ingenieur.
Deutsche Vereinigung für Geflügelwissenschaft e. V.
Die Deutsche Vereinigung für Geflügelwissenschaft e.V. fördert als nationale Gruppe innerhalb der World's Poultry Science Association - WPSA - den wissenschaftlichen Fortschritt in der Geflügelwirtschaft. Link zur Website der deutschen Vertetung: www.wpsa.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen