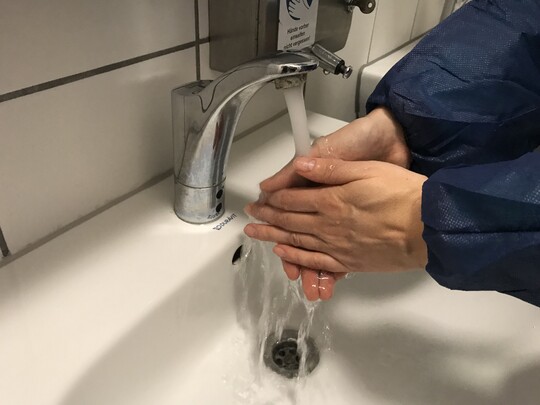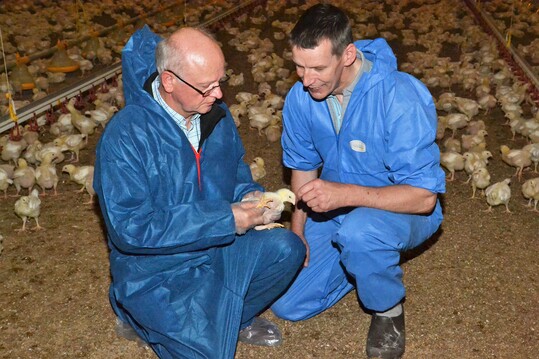Warum Desinfektion über das Pflichtprogramm hinausgeht
Konsequente Hygiene entscheidet in der Geflügelhaltung über Tiergesundheit, Arbeitssicherheit und die wirtschaftliche Stabilität des Betriebs. Neue Erkenntnisse aus einer Schulung von Fokus Tierwohl zeigen, warum Desinfektion mehr ist als Routine – und welche Fallstricke Landwirte unbedingt kennen sollten.
von Vivien Kring Quelle Frank von der Haar, Webinar erschienen am 29.08.2025Stallhygiene gehört zu den stillen Fundamenten der Geflügelhaltung. Sie fällt im Alltag oft erst auf, wenn etwas schiefläuft – etwa wenn Krankheiten auftreten, Leistungseinbußen zunehmen oder Versicherungen im Schadensfall Ansprüche ablehnen. Dabei ist Hygiene von Anfang an Teil der betrieblichen Verantwortung. „Stallhygiene ist wie Brandschutz – ohne geht es nicht“, stellte Dipl.-Ing. agr. Frank von der Haar, staatlich anerkannter Desinfektor aus dem Landkreis Osnabrück, im August 2025 bei einem Webinar von Fokus Tierwohl klar.
Rechtlich untermauert wird diese Aussage durch die EG-Verordnung 178/2002 zur Lebensmittelsicherheit. Sie verpflichtet Betriebe, die Tierhaltung so zu gestalten, dass keine Risiken für die Lebensmittelsicherheit entstehen. Hygienemaßnahmen sind daher kein freiwilliger Beitrag, sondern ein verpflichtender Bestandteil der landwirtschaftlichen Sorgfaltspflicht. Wer sie vernachlässigt, riskiert nicht nur Krankheitsausbrüche, sondern auch Probleme bei Kontrollen durch Behörden oder Zertifizierungsstellen.
Auch der Aspekt der Produkthaftung spielt eine Rolle. Nach deutschem Recht haften Produzenten von Primärprodukten gegenüber ihren Abnehmern – eine verschärfte Sorgfaltspflicht, die sich nur durch lückenlose Dokumentation und den Einsatz geprüfter Verfahren absichern lässt. Hygiene ist damit zugleich Bestandteil des Verbraucherschutzes.
Handelspräparate statt Rohstoffe
Immer wieder taucht in der Praxis die Frage auf, ob Rohstoffe wie Ameisensäure, Peressigsäure oder Natronlauge als Desinfektionsmittel geeignet sind. Sie sind in Tierseuchenrichtlinien zwar als Notfalloptionen genannt, doch rechtlich gelten sie nicht als geprüfte Desinfektionsmittel. Der entscheidende Unterschied zeigt sich bei der Haftungsfrage.
Nur Handelspräparate, die als Desinfektionsmittel ausgelobt und geprüft sind, bieten rechtliche Sicherheit. Sie sind auf der Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) verzeichnet und tragen eine gültige BAuA-Registrierungsnummer, die ihre Verkehrsfähigkeit bestätigt. Mit dieser Kennzeichnung deckt die Produkthaftung der Hersteller die geprüfte Wirksamkeit ab, wenn der Anwender nachweislich nach Herstellervorgaben gearbeitet hat. Mögliche Korrosions- oder Umweltschäden liegen in der Verantwortung des Anwenders, weil der Hersteller die Fülle der unterschiedlichen Voraussetzungen am Einsatzort bei seiner Produktprüfung nicht berücksichtigen kann.
Wer hingegen Rohstoffe einsetzt, bewegt sich in der Eigenverantwortung mit Nachweispflicht der Wirksamkeit. Hier übernimmt kein Hersteller eine Verantwortung. Einzig wenn eine Behörde durch den Amtstierarzt die Anwendung ausdrücklich schriftlich anordnet, geht die Verantwortung auf die anweisende Stelle über. Für Landwirte bedeutet das: Nur mit geprüften Handelspräparaten sind sie rechtlich und wirtschaftlich auf der sicheren Seite.
Zulassung und Verkehrsfähigkeit
„Noch verkehrsfähig“ – dieser Begriff sorgt in der Praxis häufig für Verwirrung. Gemeint ist nicht das technische Haltbarkeitsdatum eines Präparats, sondern die rechtliche Zulassung. Desinfektionsmittel müssen eine aktuelle BAuA-Nummer auf dem Etikett tragen, andernfalls dürfen sie nicht mehr eingesetzt werden.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aktualisiert regelmäßig, welche Wirkstoffe zugelassen sind. Manche verlieren ihre Verkehrsfähigkeit, wenn neue toxikologische Daten vorliegen oder wenn Hersteller den Zulassungsprozess nicht fortführen, den Wirkstoff also nicht unterstützen. Landwirte sollten daher regelmäßig ihren Lieferanten darauf ansprechen, oder im E-Biomelderegister (ebiomeld.de) prüfen, ob ein Produkt weiterhin zugelassen ist. Wer mit nicht mehr verkehrsfähigen Präparaten arbeitet, setzt seinen Betrieb rechtlich und finanziell einem erheblichen Risiko aus – auch wenn das Mittel in der Praxis weiterhin wirken würde.
Von der Reinigung zur wirksamen Desinfektion
Desinfektion entfaltet ihre Wirkung nur auf sauberen, trockenen Flächen. Organische Reste wie Futterreste, Mist oder Staub wirken wie ein Schutzschild, für die Keime. Deshalb beginnt jede Hygienemaßnahme mit einer gründlichen Reinigung.
Je nach Haltungsform und Tierart werden Hochdruckreiniger mit 80 bis 130 bar und einem Wasserdurchsatz von 26 bis 42 Litern pro Minute zur Stallreinigung eingesetzt. Geräte mit geringer Wassermenge bei Ställen mit viel Einrichtung, hohe Wassermengen haben sich in den Geflügelmastställen bewährt. Geringerer Druck mit entsprechender Tröpfchengröße sorgt für weniger „Keim-Verwirbelung“ bis an die Stalldecke. Es sollte, laut von der Haar, vor der Grobreinigung immer eingeweicht werden, da die stark verschmutzten Tierkontaktflächen so deutlich schneller und materialschonender gereinigt werden können. Schaumreiniger unterstützen diesen Prozess bei fachgerechtem Einsatz, weil so auch hartnäckige Fett- und Eiweißfilme gut entfernt werden. Beim letzten Reinigungsgang wird in waagerechten Schwenkbewegungen die Restverschmutzung von oben nach unten abgespült. So wird verhindert, dass bereits gereinigte Flächen durch Schmutzwasser wieder verunreinigt werden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen senkrechte Flächen, Zu- und Abluftanlagen sowie schwer zugängliche Einrichtungsgegenstände.
Nach der Reinigung folgt die Rücktrocknung. Bleiben Flächen feucht, „schwimmt“ die Desinfektionslösung auf dem Wasserfilm und verteilt sich ungleichmäßig. Das Ergebnis ist eine mangelhafte Wirksamkeit durch Verdünnung der Gebrauchslösung um bis zu Faktor 10. Das Kriterium für den richtigen Einsatzzeitpunkt der Desinfektion: „Erst wenn der helle „Grauschimmer des Betons“ wieder sichtbar wird, sind die Oberflächen bereit für die nächste Stufe.“
Die Keimreduktion lässt sich messen: Vor der Reinigung finden sich bis zu zehn Millionen Bakterien pro Quadratzentimeter Stallfläche. Nach einer guten Reinigung sinkt dieser Wert auf eine Millionen. Erst die Desinfektion kann die Zahl auf etwa hundert reduzieren und unter die Infektionsschwelle drücken. Jeder unbehandelte Quadratzentimeter birgt die Gefahr einer Neuinfektion, da sich Bakterien unter optimalen Bedingungen alle 20 Minuten verdoppeln können.
In der Praxis stellt sich häufig die Frage, wie der Erfolg einer Desinfektion überprüft werden kann. Frank von der Haar ging in seinem Vortrag darauf nicht im Detail ein, weil erprobte Desinfektionsverfahren, bei richtiger Ausführung, in der Praxis erfolgreich sind . In vielen Zertifizierungs- und Qualitätssicherungssystemen ist es jedoch üblich, die Wirksamkeit durch Abklatschtests oder Tupferproben zu kontrollieren. Solche mikrobiologischen Untersuchungen zeigen, ob die angestrebte Keimreduktion auch erreicht wurde und hält das Bewusstsein für die nötige Sorgfalt hoch. Sie ersetzen nicht die gewissenhafte Durchführung der Reinigung und Desinfektion, können aber als zusätzliches Instrument dienen, um die Wirksamkeit im Betrieb zu dokumentieren und mögliche Schwachstellen aufzudecken.
Mittel, Methoden und Mythen
Die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels hängt vom Wirkspektrum ab. Besonders empfindlich reagieren Mycoplasmen, die Atemwegs- und Gelenkserkrankungen verursachen können, sowie behüllte Viren wie die Erreger der Geflügelpest. Widerstandsfähiger sind unbehüllte Viren, Bakterien, Pilzsporen oder Mykobakterien. Parasiteneier und Oozysten sind am schwierigsten zu bekämpfen und bedürfen besonderer Sorgfalt bei Reinigung und Desinfektion mit entsprechendem Technikeinsatz zum Schäumen.
Von Resistenzen im klassischen Sinn kann jedoch nicht die Rede sein. Probleme entstehen vielmehr durch Wirkungslücken, die in der Regel auf falsche Dosierungen, eine ungeeignete Mittelwahl oder fehlerhafte Anwendung zurückzuführen sind. Als Standardverfahren gelten heute die Nass- und Schaumdesinfektion. Hier werden Tröpfchengrößen > 30 µm auf die Flächen gebracht, so dass der Wirkstoff in die Poren „gespült“ wird. Die Schaumdesinfektion hat zudem den Vorteil, dass sich die Auftragung besser kontrollieren lässt und das Mittel länger an der Oberfläche haftet. Zudem wird mittels Schaum erstmals auch die geforderte Menge Gebrauchslösung von 0,4L/m² an Decken und Wänden erreicht.
Von der Haar sprach sich deutlich gegen die Vernebelungstechnik aus. Die entstehenden Tröpfchen sind < 10 µm, sie lagern sich zwar auf Oberflächen ab, enthalten jedoch zu wenig Wasser, um den Wirkstoff in Poren und Hohlräumen zu spülen, damit Keime ausreichend benetzt und wirksam inaktiviert werden können. Zudem ist die dazu zwingend notwendige optimale Luftfeuchtigkeit von 100%, mit entsprechender Abdichtung, in vielen Ställen durch die baulichen Voraussetzungen nahezu unerreichbar. Hinzu kommt: Der Nebel ist lungengängig, belastet Mensch und Tier sowie Inventar und Technik durch Korrosion. Zudem unterliegt die Vernebelung strengen Arbeitsschutzauflagen – bis hin zur Genehmigungspflicht.
Auch die Desinfektionswannen für Stiefel sind ein kontroverses Thema. Ihr größtes Problem ist die Einwirkzeit ohne Schuhwechsel: Beim schnellen Durchschreiten ist sie viel zu kurz, um Keime zuverlässig zu inaktivieren, denn die Sohlen trocknen nach dem Gang durch die Wanne zu schnell ab. Optimal ist die Nutzung mit Schuhwechsel im Vorraum, weil die Stallstiefel lange genug in der Desinfektionswannen verbleiben und nach der Stallarbeit mit gereinigter Sohle wieder eingestellt werden können. Die Berechtigung der Wannen hat einen anderen wesentlichen Aspekt: sie wirken als permanente Erinnerung an Hygieneregeln und schaffen so ein Bewusstsein für Biosicherheit – ein psychologischer Effekt, der nicht unterschätzt werden sollte.
Arbeitsschutz: Verantwortung für Menschen im Stall
Hygienemaßnahmen zielen nicht nur auf Tiergesundheit, sondern auch auf den Schutz der Menschen im Stall. Viele Desinfektionsmittel sind ätzend oder reizen die Atemwege und die Keim- und Schmutzbelastung der Stallluft ist bei Betreuungs- und Reinigungsarbeiten auch nicht zu unterschätzen! Ohne persönliche Schutzausrüstung steigt das Risiko für Haut- und Atemwegserkrankungen erheblich.
Die Standardausrüstung umfasst chemikalien- und säurefeste Handschuhe, Gummistiefel, Schutzanzug, Schutzbrille oder Visier, Gehörschutz und mindestens einen FFP3-Mundschutz. Für bestimmte Arbeitsgänge oder Mittel sind ABEK-Filter sinnvoll. Sie schützen vor organischen Dämpfen (A), anorganischen Gasen (B), sauren Gasen (E) und Ammoniak (K). In der Praxis reicht für alltägliche Reinigungsvorgänge jedoch häufig ein FFP3-Filter aus. Zur Betriebshygiene gehört auch die Handdesinfektion. Spender mit Sensorsteuerung reduzieren nicht nur den Mittelverbrauch, sondern senken auch das Risiko von Kreuzkontaminationen. Sie ersetzen keine Stiefeldesinfektion, sondern ergänzen sie.
Dokumentation: Pflicht und Schutzschild zugleich
Ein oft unterschätzter Punkt ist die Dokumentation. „Wer schreibt, der bleibt“, brachte es von der Haar auf den Punkt. Jede Maßnahme, jedes eingesetzte Mittel und jede Dosierung sollten schriftlich festgehalten werden. Dazu gehören auch die BAuA-Nummern, Haltbarkeitsangaben und die Unterschriften von Dienstleistern. Gerade bei Unsicherheiten hinsichtlich der Produktzulässigkeit lässt sich ein zuverlässiger Lieferant mit einer schnell erstellten schriftlichen „Arbeitsanweisung“ zum Mitteleinsatz mit Datum und Unterschrift identifizieren, weil er nur so Mitverantwortung für das gelieferte Produkt übernimmt. In vielen Zertifizierungssystemen wie QS, KAT oder GMP+ ist eine lückenlose Dokumentation ohnehin Pflicht. Sie dient nicht nur der internen Nachvollziehbarkeit, sondern ist im Ernstfall der einzige Nachweis, dass Hygienevorschriften eingehalten wurden. Fehlerhafte oder fehlende Dokumentation kann im Schadensfall zu erheblichen Haftungsproblemen führen – bis hin zur Umkehr der Beweislast.
Fazit: Biosicherheit beginnt im Detail
Desinfektion in der Geflügelhaltung ist mehr als eine routinemäßige Pflicht. Sie ist eine Schlüsselmaßnahme für Tierwohl, Arbeitsschutz und wirtschaftliche Stabilität. Wer zugelassene Handelspräparate verwendet, die Reinigung sorgfältig durchführt, auf Rücktrocknung achtet, bewährte Ausbringungstechniken einsetzt, den Arbeitsschutz ernst nimmt und alles lückenlos dokumentiert, schafft die Grundlage für einen gesunden Tierbestand und die Absicherung des eigenen Betriebs.
„Desinfektion ist wie eine Feuerversicherung“, betonte Frank von der Haar im Webinar von Fokus Tierwohl. Man hofft, sie nie zu benötigen – doch ohne sie riskiert man im Ernstfall den gesamten Betrieb, wenn es „brennt“.
1Im Webinar von Fokus Tierwohl referierte Frank von der Haar, staatlich anerkannter Desinfektor über das Thema „Hygiene als betriebliche Grundlage – kein freiwilliger Beitrag, sondern ein verpflichtender Bestandteil der landwirtschaftlichen Sorgfaltspflicht“. Handelspräparate, die als Desinfektionsmittel ausgelobt und geprüft sind, bieten rechtliche Sicherheit und sind auf der Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) verzeichnet. Sie tragen eine gültige BAuA-Registrierungsnummer, die ihre Verkehrsfähigkeit bestätigt. Ob Produkte noch weiterhin zugelassen sind, erfahren Landwirte von ihren Lieferanten oder im E-Biomelderegister (ebiomeld.de). Wirkungsvolle Desinfektion entfaltet ihre Wirkung nur auf sauberen, trockenen Flächen. Die Standardausrüstung umfasst chemikalien- und säurefeste Handschuhe, Gummistiefel, Schutzanzug, Schutzbrille oder Visier, Gehörschutz und mindestens einen FFP3-Mundschutz. Jede Maßnahme, jedes eingesetzte Mittel und jede Dosierung sollten schriftlich festgehalten werden. Dazu gehören auch die BAuA-Nummern, Haltbarkeitsangaben und die Unterschriften von Dienstleistern.