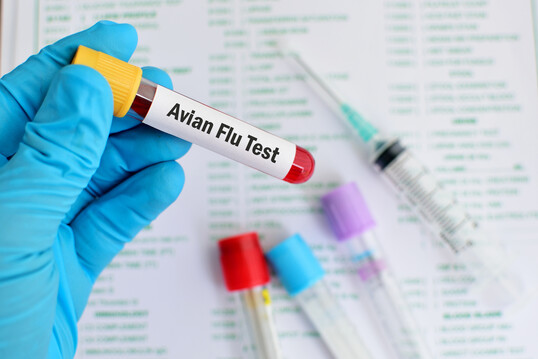Aviäre Influenza (AI)-Monitoring bei Puten
Die niedersächsische Putenwirtschaft hat die Geflügelpest-Geschehnisse der letzten Jahre zum Anlass genommen, ein Frühwarnsystem zur schnelleren Erkennung von Influenza-Viren im Putenstall zu erproben.
- Veröffentlicht am

Der Verband Deutscher Putenerzeuger e. V. (VDP) hatte am 18. Oktober 2022 Interessierte aus Verbänden, Zuchtunternehmen, Vermarktung, Tierarztpraxen und Tierhaltende nach Hannover zu dem Workshop Aviäre Influenza (AI)-Monitoring bei Puten geladen, um das Tränkewasser-Monitoring und die bisherigen positiven Erfahrungen mit dem Verfahren vorzustellen.
Risiko-orientiertes Geflügelpest-Monitoring
Im letzten Winter wurde in der Kernregion der Putenhaltung im Landkreis Cloppenburg ein Geflügelpest-Monitoring durchgeführt. Hier stand besonders die Beprobung des Tränkewassers im Fokus, welches einfach, schnell und kostengünstig durchzuführen ist.
Das Tränkewasser-Monitoring hat sich als bewährte Methode herausgestellt, um AI-Viruseinträge schneller zu erkennen und weitere Sekundärausbrüche zu verhindern. Es hat sich gezeigt, dass Tränkemonitoring auf Aviäre Influenza grundsätzlich gut geeignet ist, um ein schnelles, günstiges und praktikables Monitoring aufzubauen.
Die bisherige Beprobungsfrequenz auf den Betrieben war 2x pro Woche. Die Erfahrungen mit dem Monitoring haben gezeigt, dass eine Umstellung des Monitorings von der bisherigen kontinuierlichen Beprobung auf eine risikoorientierte Beprobung möglich und sinnvoll ist.
Das risikoorientierte Tränkemonitoring sollte um HPAI-Primärausbrüche (Eintrag in eine) herum, unabhängig von der betroffenen Geflügelart, über zwei Wochen in einem Radius von 10 km, 2 bis 3 Mal (in Abhängigkeit von Gebietskulisse und Logistik) wöchentlich durchgeführt werden. Absprachen mit dem Veterinäramt sind sinnvoll.
Tränkewasser-Monitoring in Putenbetrieben innerhalb 10 km um Ausbruchsbestand
Das Monitoring sollte grundsätzlich in Putenbeständen um jegliche Primärausbrüche im 10 km-Radius durchgeführt werden. Je nach Gebietskulisse kann es sinnvoll sein, auch bei neu auftretenden HPAI-Fällen im Wildvogelbestand zu beproben.
Für Regionen mit einer geringeren Tierhaltungs- und Labordichte kann die Organisation der Probenlogistik problematisch sein. Hier sollten bereits im Vorfeld mögliche Strukturen identifiziert und geprüft werden. Aktuellen HPAI-Ausbrüche werden auf Karten des FLIs dargestellt. Auch das Tierseucheninformationssystem (TSIS) listet aktuelle Fälle der Geflügelpest.
Impfstrategien gegen Aviäre Influenza
Anknüpfend an den Vortrag von Frau Dr. Kloska zu dem Thema Impfung gegen AIV H5 und H7 wurden die Möglichkeiten und offenen Fragestellungen zur Impfung gegen Aviäre Influenza diskutiert. Nach aktuellem bzw. zu erwartendem EU-Recht werden auch geimpfte Geflügelbestände bei einem HPAI-Eintrag gekeult werden. Die Impfung kann aber Sekundärausbrüche verhindern.
Grundsätzlich muss eine Impfung mit einem intensiven Surveillance-System flankiert werden, um eine Feldvirus-Zirkulation trotz Impfung zu verhindern. Hier bietet sich auch das Tränkemonitoring an. Diese Möglichkeit muss mit dem FLI diskutiert werden.
Da auf die Impfung gegen HPAI Handelsrestriktionen folgen können, wird der Ansatz entwickelt, eine Regionalisierung analog zu HPAI-Ausbrüchen auch für Regionen, in denen geimpft wird, zu etablieren. Interessant für den Einsatz der Impfung sind insbesondere Großeltern- und Elterntierherden.