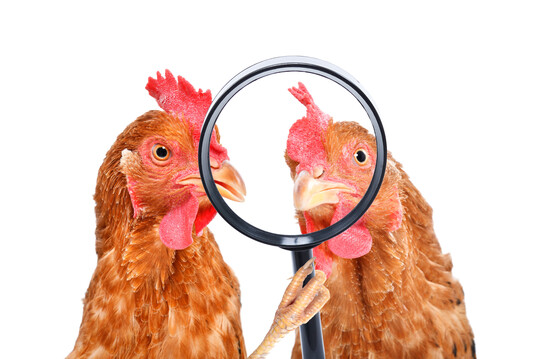Geflügelwirtschaft im Wandel: Über Käfige, Marktentwicklungen und den Blick nach vorn
Das Verbot der Käfighaltung für Legehennen, die Rot-Weiß-Verschiebung am Fleischmarkt und die deutsche Wiedervereinigung – wir sprachen mit Prof. em. Hans Wilhelm Windhorst über diese und weitere prägende Ereignisse aus 75 Jahren Geflügelwirtschaft. Kaum jemand kennt die Branche so gut, wie der international anerkannte Wissenschaftler.
- Veröffentlicht am

DGS: Herr Windhorst, Sie sind der DGS schon seit vielen Jahren als Autor und Leser treu und haben in der Vergangenheit immer wieder über die nationalen und internationalen Entwicklungen in der Geflügelbranche berichtet. Welche Ereignisse, vor allem in Deutschland bzw. der EU, haben Sie als besonders einschneidend erlebt?
Prof. em. Hans-Wilhelm Windhorst: Einer der stärksten Eingriffe in die Geflügelwirtschaft war sicherlich das Verbot der Käfighaltung von Legehennen. Nach Jahren der Diskussion trat dann in Deutschland das Verbot ein Jahr früher in Kraft als in nahezu allen anderen Mitgliedsländern der EU. Zunächst war der Widerstand sehr groß, weil das als Benachteiligung angesehen wurde. Es zeigte sich aber, dass der frühere Ausstieg auch wirtschaftliche Vorteile hatte, weil man früher als die Mitbewerber Eier aus den alternativen Haltungsformen für den Markt bereitstellen konnte und dadurch Vorteile hatte.
Können Sie auch kurz erklären, wie die Henne überhaupt in den Käfig kam?
Das hing sehr stark mit der Firma Big Dutchman zusammen. Vertreter des Unternehmens haben sich in den USA solche Käfiganlagen angeschaut, diese in Deutschland nachgebaut und weiterentwickelt. Der Einbau einer automatischen Tränke und Fütterung stammt zum Beispiel von dem bekannten Hersteller aus Norddeutschland. Diese verbesserte Form des Käfigs wurde dann nicht nur exportiert, sondern auch in Deutschland vertrieben.
Gab es noch weitere, prägende Ereignisse im Geflügel–Deutschland?
Ein anderer tiefgreifender Einschnitt war die Wiedervereinigung. Zusammen mit einem Kollegen habe ich 1988 und 1989 im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine Bestandsaufnahme zu den sogenannten KIM-Betrieben (Kombinate Industrielle Mast) erstellt. Das war nicht immer ganz einfach, weil wir immer beaufsichtigt wurden und kaum freie Gespräche führen konnten. Die Studie war dann die Grundlage für die Überführung der Betriebe in Privat- bzw. Genossenschaftsbesitz nach der Wiedervereinigung.
Und wie lief anschließend die Überführung der KIM-Betriebe?
Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Betriebe, die für damalige Verhältnisse modern waren und eine günstige Lage recht nah an der ehemaligen Grenze hatten, wurden mit Kusshand übernommen – andere, die überaltert waren, löste man auf. Manche KIM-Betriebe hatten zwischen 200 und 300 Angestellte, von denen mit der Wende viele freigestellt wurden. Das war notwendig, damit wieder gewinnbringend gewirtschaftet werden konnte.
Welche internationalen Entwicklungen haben Sie besonders beeindruckt bzw. waren besonders prägend für Ihre Arbeit?
Eine Entwicklung, die ich über einen längeren Zeitraum beobachtet habe, war der Siegeszug des Geflügelfleisches. Zu der von mir so genannten Rot-Weiß-Verschiebung habe ich zahlreiche Publikationen erarbeitet. Dieser Prozess läuft immer noch und hat zu beträchtlichen Veränderungen nicht nur in der Fleischerzeugung, sondern auch im Fleischhandel geführt. Eine weitere Entwicklung, die ich schon als großen Einschnitt genannt habe und auch im Rahmen meiner Forschungen genau beobachtet habe, war die Abkehr von der Käfighaltung von Legehennen.
Zuerst wurde sie stark boykottiert: Die deutschen Eiererzeuger fürchteten, Eier würden zu teuer werden und ihnen würde damit ein großer Wettbewerbsnachteil entstehen. Das war die Geburtsstunde des ausgestalteten Käfigs, der eine Übergangslösung werden sollte. Zwar waren Deutschland und die EU Vorreiter, aber es zeigte sich schon bald, dass die Diskussion um die Käfighaltung auch in anderen Ländern geführt wurde.
Langsam zeichnete sich eine Veränderung ab, so z. B. in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA. Für die International Egg Commission (IEC) in London, für die ich etwa 15 Jahre als Statistical Analyst gearbeitet habe, habe ich eine umfangreiche Studie zu diesem Thema erstellt.
Prof. em. Hans-Wilhelm Windhorst
wurde am 20. Mai 1944 in Stemwede geboren. 1977 habilitierte er an der damaligen Universität Osnabrück zur spezialisierten Agrarwirtschaft in Südoldenburg. Als wissenschaftlicher Leiter des Niedersächsischen Kompetenzzentrums Ernährungswirtschaft (NieKE; 1999 bis 2011) und des Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING; 2012 bis Mitte 2021) forscht er schwerpunktmäßig u. a. zu räumlichen Verlagerungsprozessen in der Tierproduktion und alternativen Proteinquellen.
Hierfür unternahm er bereits zahlreiche Studienreisen nach Nord-, West- und Südeuropa, in die Golfstaaten und nach Thailand. Für über 30 Forschungsaufenthalte reiste er in die USA und nach Kanada. Bisher veröffentlichte er mehr als 1.000 Fachartikel und Bücher.
Würden Sie rückblickend sagen, dass jede Veränderung bzw. jedes Verbot auch die Chance für Weiterentwicklung bzw. Verbesserung bot?
Neben der bereits genannten Umstellung in den Haltungsformen für Legehennen hat das Auftreten und die schnelle Ausbreitung der Aviären Influenza (Geflügelgrippe) sich sowohl negativ als auch positiv ausgewirkt. Durch die Erkenntnis, dass man es mit einer wiederkehrenden hochinfektiösen Seuche zu tun hat, die hohe wirtschaftliche Verluste zur Folge hat, wurden in den meisten Ländern, die davon betroffen waren, die Hygienestandards in den Betrieben deutlich verbessert.
In Deutschland ist es darüber hinaus durch die Gründung der Gesevo GmbH (Gesellschaft für Seuchenvorsorge) im Jahr 2008 zu einer Professionalisierung der Seuchenbekämpfung gekommen, die richtungsweisend war.
Deutschland im internationalen Vergleich: Wo könnte die deutsche Geflügelbranche möglicherweise von der amerikanischen lernen – und umgekehrt?
Im internationalen Vergleich nimmt die deutsche Geflügelwirtschaft eine Spitzenstellung ein hinsichtlich der tiergerechten Haltung von Legehennen, Masthähnchen und Mastputen, auch wenn es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Haltung des Mastgeflügels gibt. Aber hier darf man wirtschaftliche Aspekte nicht aus dem Auge verlieren.
Es bringt nichts, die Haltungsbedingungen durch immer neue Regelungen im Alleingang in Richtung Extensivierung weiter zu verändern, wenn man dadurch in den Produktionskosten weit über denen anderer Länder liegt, die solche Auflagen nicht haben und die dann unseren Markt beschicken. Damit ist dann für das Tierwohl nichts gewonnen.
In den USA werden die technische Entwicklung und die Richtlinien bzgl. einer tiergerechten Haltung genau beobachtet. Die dort zurzeit ablaufende Abkehr von der Käfighaltung erfolgt in hohem Maße mit deutscher Technologie.
Herr Windhorst, welche Entwicklung könnte in Zukunft die Geflügelwirtschaft einschneidend verändern?
Ich beschäftige mich seit etwa zehn Jahren sehr intensiv mit der Entwicklung alternativer Proteine. Dazu habe ich mehrere Studienreisen in die USA durchgeführt und dort führende Start-ups besucht. Wir werden mit den bisherigen Produktionsformen nicht genug Lebensmittel für die weiterwachsende Weltbevölkerung erzeugen können.
Es muss also nach Alternativen gesucht werden, sei es durch Erzeugung auf Pflanzenbasis, durch Fermentation oder auch durch Zellkulturen. Während die Erzeugung von Fleisch- und Eiersatzprodukten auf pflanzlicher Basis schon weit fortgeschritten ist, befinden sich die beiden anderen Alternativen noch in einem frühen Entwicklungsstadium.
Gerade bei der Erzeugung von Fleisch aus Zellkulturen gibt es noch viele Probleme wegen der hohen Kosten und der Schwierigkeit der Erzeugung in Großanlagen. Es ist und bleibt eine spannende Entwicklung. Welche Möglichkeiten sich hier eröffnen, hat neben der Rügenwalder Mühle z. B. auch die PHW-Gruppe früh erkannt und entsprechende Investitionen getätigt. Beide Unternehmen bieten sowohl vegane Wurstprodukte als auch Fleischalternativen auf Pflanzenbasis im Einzelhandel an.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch!
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen