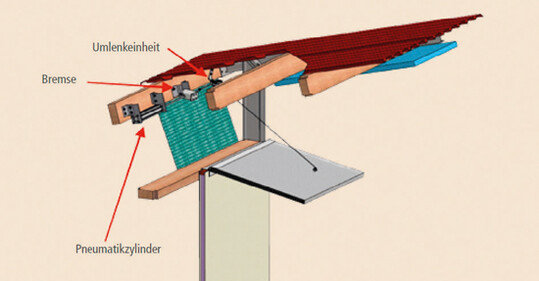Betriebsreportage
Zwischen Wintergarten und Wärmetauscher
An der bayerisch-württembergischen Grenze führt Ernst Linder den Hof seiner Familie mit drei Putenmast- und zwei Aufzuchtställen. Außenklimabereiche, moderne Technik und transparente Haltung prägen seinen Betrieb und schaffen Akzeptanz.
- Veröffentlicht am

Es ist ein regnerischer, wolkenverhangener Tag an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Die Landschaft wirkt gedämpft, die Felder glänzen feucht, und ein alter Pick-up wühlt sich durch den aufgeweichten Feldweg. Am Steuer sitzt Ernst Linder. Vom Wohnhaus der Familie sind es nur wenige Hundert Meter bis zu den Putenställen, in denen Aufzucht und Mast stattfinden. Auf der kurzen Fahrt wirkt Linder zugewandt; er lacht oft, und seine auffallend strahlend blauen Augen leuchten, wenn er von seiner Arbeit spricht. Linder ist Hobbyjäger, Trophäen hängen an der Wand seines Hauses – an diesem Tag aber geht es um seinen Betrieb und die Tiere, die hier gehalten werden. Vom Rinderhof zur Putenmast Der Hof begann als kleinbäuerlicher...