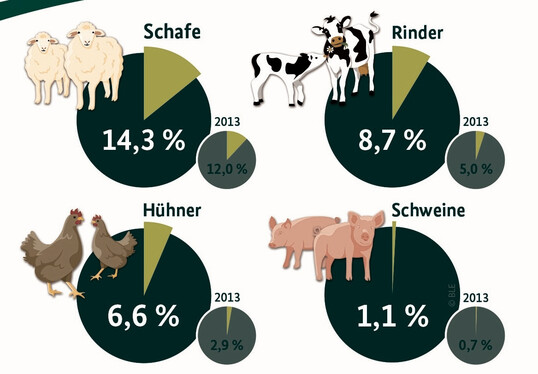
Ökologische Geflügelhaltung: Disziplin mit hohen Ansprüchen
Das 14. Dresdner Kolloquium stand im Zeichen der ökologischen Geflügelhaltung. In der Legehennenhaltung hat sich gezeigt, dass ein zunehmend komplexes Management erforderlich ist.
von Dr. Anke Redantz erschienen am 30.09.2025Bereits zum 14. Mal fand am 10. Juni 2025 in Dresden das Dresdner Kolloquium statt – eine gemeinsame Veranstaltung des Friedrich-Loeffler-Instituts, der Sächsischen Tierseuchenkasse und der Sächsischen Landestierärztekammer. In diesem Jahr widmete sich die Veranstaltung der ökologischen Geflügelhaltung.
Die Nachfrage nach Biolebensmitteln steigt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich. Im Jahr 2024 erreichte der Umsatz an ökologisch erzeugten Produkten ein neues Rekordniveau. Mit diesen Worten begrüßte Prof. Dr. Getu Abraham von der Universität Leipzig, Veterinärmedizinische Fakultät, Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie, die Zuhörer. Parallel zum Marktwachstum hat auch die Zahl ökologischer Haltungsplätze für Legehennen zugenommen. Das Wachstum der Biogeflügelhaltung lässt jedoch zunehmend spezifische Herausforderungen zutage treten – insbesondere im Bereich Tiergesundheit und beim Einsatz von Arzneimitteln.
Arzneimitteleinsatz im Biobetrieb: Strikte Regeln
Die Grundlage der ökologischen Geflügelhaltung in Europa bildet die EU-Öko-Verordnung 2018/848. Sie legt den rechtlichen Rahmen für Erzeugung, Kennzeichnung und Kontrolle ökologischer Erzeugnisse fest. Im Zentrum steht der präventive Ansatz: Die Tiergesundheit soll primär durch vorbeugende Maßnahmen wie artgerechte Haltung, angepasste Fütterung, Zuchtstrategien sowie Hygienemaßnahmen gewährleistet werden.
Der Einsatz von Arzneimitteln ist dabei auf das absolut notwendige Maß zu beschränken, betonte Abraham. Die ökologische Geflügelhaltung verfolge demnach einen konsequent präventiven Ansatz: Vorbeugung vor Behandlung. Wenn doch behandelt werden muss, greifen strenge Regeln.
Die Behandlung kranker Tiere ist im Biobetrieb ausdrücklich erlaubt – allerdings unter klar definierten Bedingungen. So gelten für ökologisch gehaltene Tiere deutlich längere Wartezeiten: Die für den konventionellen Bereich festgelegten Wartezeiten verdoppeln sich. Ist keine Wartezeit angegeben, dann beträgt diese im ökologischen Bereich mindestens 48 Stunden.
Praktische Herausforderungen: Therapielücken und Umwidmung
Mit dem wachsenden Marktanteil ökologischer Geflügelprodukte steigt der Bedarf an geeigneten Tierarzneimitteln. Abraham wies darauf hin, dass bei bestimmten Krankheitsbildern eine gezielte Weiterentwicklung therapeutischer Optionen erforderlich sei, um hier eine Versorgungslücke zu vermeiden.
Seit Inkrafttreten der EU-Tierarzneimittelverordnung (EU) 2019/6 im Jahr 2019 ist die Umwidmung von Arzneimitteln erleichtert (Art. 106). Dadurch können Tierärzte in begründeten Fällen schneller und gezielter auch solche Arzneimittel einsetzen, die ursprünglich nicht für Geflügel zugelassen wurden. Auch bei der Umwidmung gilt: Die Mindestwartezeiten müssen eingehalten werden.
Strengere Verbandsrichtlinien
Verbände wie Demeter oder Bioland regeln den Arzneimitteleinsatz teilweise noch strenger. So gibt Demeter beispielsweise vor, Präparate mit einer kurzen Wartezeit zu bevorzugen. Behandeln Betriebe häufiger als zulässig, dann dürfen die Produkte nicht mehr als Demeter-Ware vermarktet werden. Außerdem müssen Anwendungen von Antibiotika, die ohnehin streng limitiert sind, auf die erkrankte Gruppe begrenzt werden. Die Bioland-Richtlinie (Stand 2023) ist weitgehend identisch mit der Demeter-Vorgabe, enthält überdies aber noch eine detaillierte Liste erlaubter und verbotener Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen.
Mehr Aufwand, mehr Verantwortung – für alle
Dr. Thorsten Arnold, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Arnold in Ankum, schilderte die Anforderungen an die tierärztliche Betreuung in ökologischen Junghennenaufzuchten und Legehennenhaltungen. Er erläuterte, dass sich seit Inkrafttreten der EU-Öko-Basisverordnung 2018/848 die Rahmenbedingungen für die ökologische Geflügelhaltung deutlich verändert haben. Während das Regelwerk ursprünglich der Harmonisierung und Qualitätssicherung dienen sollte, zeigt sich in der Praxis: Die Arbeit ist komplexer geworden. Davon betroffen sind Themen wie Wartezeiten, Zugang zu Auslauf, Futtermittelzusammensetzung sowie die praktische Umsetzbarkeit der Vorgaben. Für Betriebe und beratende Tierärzte bedeutet das: höherer Aufwand – und mehr Verantwortung.
Auslauf mit Risiken
Der Zugang zum Auslauf gilt als Beitrag zum Tierwohl – bringt jedoch auch gesundheitliche Risiken mit sich. Besonders problematisch sind Verluste durch Beutegreifer, etwa durch den Seeadler in Norddeutschland. Darüber hinaus wies Arnold auf mikrobiologische Belastungen im Auslauf hin, beispielsweise durch feuchte Flächen, Pfützen und kontaminierte Böden. Die möglichen Folgen: Die Tiere können mit Spul- und Blinddarmwürmern befallen oder mit Erregern wie Histomonas meleagridis (Schwarzkopf), Campylobacter, Escherichia (E.) coli, Streptococcus gallinaceus sowie Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf) infiziert werden. Gerade bei den mittlerweile üblichen längeren Legeperioden nimmt der Impfschutz gegen Rotlauf ab, wodurch ältere Herden erneut anfällig werden. Einmal infizierte Tiere kontaminieren den Auslauf – ein Kreislauf, der schwer zu durchbrechen ist.
Ergänzungsfuttermittel mit Biozulassung auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung der Tiere gegen Würmer sind aufwendig und durch ihre Formulierung zum Teil schwierig zu verabreichen – mit nur mäßigem Erfolg gegen den Wurmbefall. Häufig bleibt dann nur eine Behandlung mit synthetisch-allopathischen Präparaten, die aber eine entsprechende Wartezeit haben. Die Eier können dann – je nach Präparat – für sieben bis neun Tage nicht als Bioeier vermarktet werden. So kann eine Entwurmung bei 12.000 Legehennen schnell 15.000 Euro kosten.
Der Schlüssel: Management und Prophylaxe
Was macht eine erfolgreiche ökologische Geflügelhaltung aus? Arnolds eindeutige Antwort: konsequentes und detailliertes Management. Fachleute schätzen, dass bis zu 80 % des Erfolgs im Management begründet liegen. Tierärzte müssen gerade in der ökologischen Haltung besonders früh ansetzen: bei der Fütterung, Hygiene, Biosicherheit, Immunprophylaxe und im Parasitenmanagement. Seine Beispiele für die kritischen Punkte aus tierärztlicher Sicht:
- die konsequente Umsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen, inkl. Schadnagerbekämpfung,
- standardisierte Prophylaxeprogramme und Einsatz bestandsindividueller Impfstoffe gegen die oben genannten bakteriellen Infektionskrankheiten in der 13. bis 14. Lebenswoche,
- Gewichts- und Uniformitätskontrolle bei Einstallung (Ziel der Uniformität: 80 bis 90 %),
- stabile Futteraufnahme bei Auslaufbeginn.
Ein häufig unterschätztes Problem in der Eingewöhnungsphase ist, dass die Tiere nicht schnell genug Futter und Wasser in der neuen Anlage im Legehennenstall finden – kleine Fehler, die die Junghennen nicht verzeihen, die aber durch ein gutes Management verhindert werden können.
Ein stabiler Verdauungstrakt ist Voraussetzung für Gesundheit und Leistung. Über diesen entscheidet unter anderem die Futterstruktur – Arnold empfiehlt regelmäßige Siebanalysen. Denn: durch eine ungünstige Futterstruktur neigt das Futter dazu, sich zu entmischen. Die Folgen: eine schlechtere Befiederung und eine schlechtere Eischalenqualität sowie niedrigere Eigewichte.
Fazit: Biohaltung – hoher Anspruch, hoher Aufwand
Seit 2022 beobachten Praktiker in der Biohaltung zunehmend komplexere Krankheitsverläufe, schlechtere Behandlungsmöglichkeiten durch längere Wartezeiten und eine generelle Zunahme an Managementanforderungen. Die neue EU-Verordnung hat viele Dinge verschärft – oft ohne Rücksicht auf die Praktikabilität im Stallalltag.
Arnolds Credo aus tierärztlicher Sicht: Tierärzte müssen sich zunehmend als Managementberater verstehen – klassische klinische Betreuung allein reicht nicht (mehr) aus. Es geht um Vorbeugung statt Reaktion, um ganzheitliches Denken statt punktueller Maßnahmen. Biogeflügelhaltung ist eine Disziplin mit hohen Ansprüchen – aber auch mit großem Potenzial für eine nachhaltige, tiergerechte Produktion.
Mobilställe – spezielle Herausforderungen
Dr. Franca Möller vom Geflügelgesundheitsdienst Hessen berichtete über die tierärztliche Bestreuung speziell von Mobilstallhaltungen. Auch wenn es Gemeinsamkeiten zur Bestandsbetreuung von Herden in stationären Ställen gibt, stellt die Mobilstallhaltung die Tierhalter vor spezielle Herausforderungen – technisch, organisatorisch und tiergesundheitlich.
Erkrankungen der Tiere ähneln denen stationärer Freilandbetriebe, allerdings verschärfen die sonst gewünschte Mobilität sowie der Einfluss von Wetterextremen die Anfälligkeiten. Darüber ist in ein gesonderter Fachbeitrag geplant.
Die Schweiz – tierschutzorientierte Programme
Auch ein Blick über die Grenzen ermöglichte das Kolloquium. Die Schweizer Geflügelhaltung gilt international als besonders tierschutzorientiert. Zwei über die gesetzlichen Mindestvorgaben herausragende Programme sind: BTS (besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme) und RAUS (regelmäßiger Auslauf im Freien). Diese Programme stellen höhere Anforderungen an Haltung, Auslauf und Stallklima – ein Plus für das Tierwohl, zugleich aber auch eine Herausforderung für das Gesundheitsmanagement und die Biosicherheit im Stall.
Dr. Sarah Albini, Labortierärztin an der Universität Zürich, zeigte anhand mehrerer Fallbeispiele, wo Chancen und Schwachstellen im System liegen – und gab zu bedenken, dass konventionelle Ansätze für Biohühner nicht immer genügen. Anhand von Beispielen aus ihrem Alltag gewährte sie einen Einblick in die tierärztliche Labordiagnostik.
Fallbeispiel: Bruderhahnmast
Eines dieser Beispiele drehte sich um die Mast von Bruderhähnen eines noch unerfahrenen Mästers. Die Herde war sehr heterogen – mit auffallend vielen Kümmerern. In der Sektion waren die Tiere abgemagert. So lag der Verdacht zunächst bei einem Fütterungsproblem. Die bakteriologische Diagnose ergab aber: Geflügelcholera (Pasteurellose), eine Krankheit, die bei konventionellen Broilern ohne Weidezugang nicht vorkommt. Geflügelcholeraausbrüche sind möglich, wenn die Tiere in verseuchte Ausläufe (z. B. alte Schaf- oder Schweineweiden) herausgelassen werden, denn der Erreger kann lange im Erdreich verbleiben. Dies betrifft nicht nur die Geflügelcholera, sondern auch Rotlauf, Histomonadose und Salmonellosen. Dieser Fall macht laut Albini deutlich: Bruderhahnmast erfordert gegenüber der konventionellen Mast ein angepasstes Gesundheitskonzept, insbesondere bei umgenutzten Weiden.
Salmonella Jerusalem – Schwachstelle Futtermittelhygiene?
Ein weiteres Beispiel drehte sich um das Auftreten von Salmonella jerusalem. Zum Hintergrund: Die Schweiz betreibt seit 2008 ein striktes Salmonellenbekämpfungsprogramm bei Masthühnern und Puten – mit Verbot der Impfung, konsequenter Hitzeentkeimung von Futtermitteln und regelmäßigen Kontrollen. Dennoch kam es 2021 in mehreren Kantonen zum Nachweis von Salmonella jerusalem aus Umgebungsproben von Biolegehennen und Biolegeelterntieren – scheinbar unabhängig voneinander. Die Betriebe hatten aber einen gemeinsamen Nenner: Das Futtermittel stammte aus derselben Biofuttermühle.
Als Ursache konnte durch Salmonella jerusalem kontaminierter Sojakuchen aus Italien ermittelt werden. Dieser wurde für die Biofuttermittelproduktion eingeführt. Anders als in der konventionellen Produktion werden Biofuttermittel in der Schweiz thermisch weniger stark behandelt – ein potenzieller Schwachpunkt.
Tiergerechte Haltung braucht gezieltes Gesundheitsmanagement
Die Schweizer Geflügelhaltung befindet sich auf einem sehr hohen Tierschutzniveau. Doch die Beispiele zeigen auch: Mit mehr Platz, Auslauf und naturnahen Bedingungen steigen auch die tiergesundheitlichen Herausforderungen. Präventive Maßnahmen, gezielte Diagnostik und transparente Futtermittel- und Hygieneketten sind dabei genauso entscheidend wie ein leistungsfähiges Überwachungssystem.
Es wurde deutlich: Auch bei bester Haltung können gesundheitliche Risiken auftreten – und erfordern schnelles, fachlich fundiertes Handeln.
Am 10. Juni 2025 fand das 14. Dresdner Kolloquium statt – ganz im Zeichen der ökologischen Geflügelhaltung. Die Veranstaltung wurde vom Friedrich-Loeffler-Institut, gemeinsam mit der Sächsischen Landestierärztekammer und der Sächsischen Tierseuchenkasse durchgeführt.
Die EU-Verordnung 2018/848 war mehrfach Gegenstand der Vorträge. Sie sollte die ökologische Geflügelhaltung harmonisieren, hat allerdings aufwendiger gemacht. Auf diese zunehmend komplexer werdenden Managementanforderungen muss sich auch die tierärztliche Bestandsbetreuung einstellen. Den vielfältigen Herausforderungen der Biohaltung kann mit fachlich fundiertem Handeln begegnet werden.











