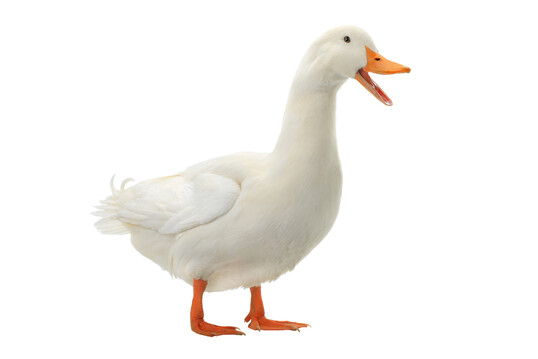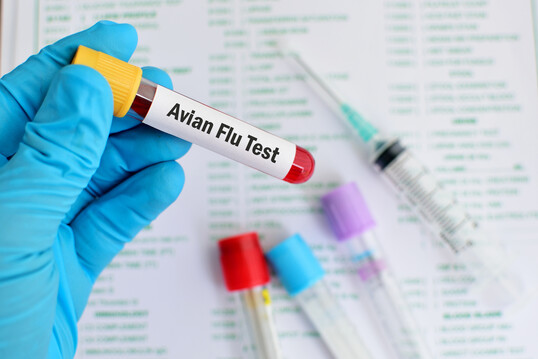Geflügelpest: (K)eine Impfung in Sicht?
Aviäre Influenza – wann kommt die Impfung, und wenn sie kommt, wer braucht sie dann noch? Zwei aktuelle Vorträge zum Umgang mit der Geflügelpest und zu einer möglichen Impfung lockten weit mehr als 300 Teilnehmer aus der Branche zum diesjährigen Osnabrücker Geflügelsymposium an die Hochschule im Herzen Niedersachsens.
- Veröffentlicht am

Nicht das Eröffnungsthema der Veranstaltung, aber mit Sicherheit das am meisten erwartete: die Aviäre Influenza (AI). Prof. Dr. Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, zeigte in seinem Vortrag den weltweiten „Siegeszug“ des H5N1-Virus auf. Fast ausnahmslos alle Erdteile seien mittlerweile von dem Erreger betroffen.
Das Virus dringe in alle Ökosysteme vor, so habe sich auch ein erster Eisbär in der Arktis durch H5N1-infizierte Beute angesteckt. Es bedrohe die Biodiversität der Vogelwelt, da an dem Erreger 2022 und 2023 ganze Kolonien von Seeschwalben, Tölpeln und Möwen verendeten. Je nachdem, welche Eigenschaften die unterschiedlichen Genotypen des Virus mitbrächten, falle die Infektion in den jeweiligen Populationen unterschiedlich schwer aus.
Zoonotisches Potenzial des AI-Virus noch gering
Eine gute Nachricht gebe es aber, so Harder. Tauben seien bisher kaum empfänglich für das Geflügelpest-Virus, da – ähnlich wie beim Menschen – deren Rezeptoren mit dem Erreger nicht zusammenpassten. Die zoonotische Wirkung des Virus sei daher noch gering. Bisher wurden weltweit beim Menschen weniger als 20 Ansteckungen mit dem HPAIV H5N1 2.3.4.4b nachgewiesen, bei denen nur zwei einen schweren klinischen Verlauf zeigten.
Je öfter sich aber Säugetiere durch die Aufnahme erkrankter Beutetiere infizierten, wachse die Gefahr, dass das Virus über Mutationen einen Weg findet, auch auf den Menschen übertragbar zu sein. Bisher seien von alimentären (durch Nahrungsaufnahme) Infektionen ca. 100 Arten von Fleischfressern (Füchse, Nerze oder Meeressäuger wie Robben und Seelöwen) betroffen. Ein weltweites H5N1-Monitoring, insbesondere von toten Karnivoren, sowie die Sequenzierung der Influenzaviren sei daher immens wichtig.
Das Osnabrücker Geflügelsymposium
Das Osnabrücker Geflügelsymposium findet seit 2009 jährlich statt. Es dient als Plattform zum Austausch und zur Diskussion aktueller Themen des Geflügelmanagements.
Seit 2015 wird es von der Hochschule Osnabrück, Studienschwerpunkt angewandte Geflügelwissenschaften (StanGe), Lehrstuhl Prof. Dr. Robby Andersson, in Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Wissenschafts- und Informationszentrum nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING), kommissarische Leitung durch Prof. Dr. Nicole Kemper und Prof. Dr. Christian Visscher, durchgeführt.
Das praxisnahe Symposium gliedert sich am Vormittag in Fachvorträge und am Nachmittag folgen Impulsreferate mit Diskussionen bzw. Workshops.
Was kann die Geflügelpest-Impfung leisten?
Die Wirkung präventiver Maßnahmen – ausgenommen die Impfung – gegen eine Infektion mit dem H5N1-Virus seien bei frei lebenden Wildtieren und dem Menschen gleich null, erklärte der Tiergesundheitsexperte. Nur bei Nutzgeflügel könne mit einer intensiven Biosicherheit Vorsorge betrieben werden. Allerdings habe man mit dem mittlerweile ganzjährigen Infektionsrisiko auch hier ein Plateau erreicht und könne die Aviäre Influenza nicht vollkommen aus den Beständen halten. Auch bliebe die letzte viertel Meile des Erregereintrages in viele Betriebe leider weiterhin rätselhaft.
Der Ruf nach einer Impfung seitens der Tierhalter sei daher mehr als verständlich, so Harder. Frankreich habe als erstes europäisches Land am 1. Oktober 2023 mit der verpflichtenden Impfung gegen die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI) für Mastentenbestände zur Herstellung von Stopflebern begonnen. Dafür habe der Nachbarstaat eine temporäre nationale Zulassung eines Impfstoffes erhalten. Die nachfolgenden Importverbote der USA gegenüber französischen und europäischen Entenprodukten seit der eingeführten Impfpflicht sei jedoch ein wichtiges Zeichen dafür, dass eine Impfung den freien Handel einschränken könne.
Bislang ist in der EU nur ein (veralteter) Impfstoff zugelassen; weltweit seien jedoch schon weitere Vakzine erhältlich. Da sich das EU-Zulassungsverfahren nicht sehr transparent zeige, sei nicht klar, wann andere Impfstoffe in Europa eine Zulassung bekämen, bedauerte der Leiter des WOAH und Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am Institut für Virusdiagnostik der Insel Riems.
Noch viele Hürden bis zu einer AI-Impfung zu überwinden
Das FLI selbst, berichtete Harder, teste derzeit neue AI-Vakzine an Gänsen. Während der Studie habe sich eine hohe Immunogenität gezeigt. Nun sei man dabei, so Harder, die Länge des Impfschutzes zu prüfen und abzuleiten, ob Auffrischungsimpfungen nötig werden. Auch die Surveillance (Überwachung) sei ein wichtiger Bestandteil der Tests, so müsse ein geimpfter Tierbestand frei von stummen Viruszirkulationen (Escape-Varianten) sein.
Die in Frankreich praktizierte Überwachung sind zum einen monatliche amtstierärztliche Untersuchungen sowie die Beprobung von 60 Tieren per PCR-Tests. Die Impfkampagne wurde über zwei Jahre vorbereitet und ist mit etwa 100 Mio. Euro staatlich hoch subventioniert, denn sie erfordere ein großes Logistikaufkommen, unzählige Probennahmen und ausreichend Laborkapazitäten. Das von Sieverding und Hafez 2023 veröffentlichte AI-Monitoring über Tränkwasser bzw. weitere Studien zur Beprobung des Einstreumaterials und der Stallluft seien bisher als alternative Methoden von der EU nicht anerkannt worden.
Harder appellierte zum Abschluss, die Impfung mit Bedacht und nur bei langlebigem Nutzgeflügel einzusetzen. Risiken wie Haltungen in Gebieten mit starker HPAI-Aktivität in Wildvögeln oder kompartimentierte Impfungen von Haltungen in Regionen mit einer hohen Dichte expositionsgefährdeter Geflügelpopulationen müssten ausgeschlossen werden. Dazu verwies er auf das im DGS-Magazin 9/2023 veröffentlichte Positionspapier zu „Nutzen und Risiken einer Impfung von Geflügel gegen Hochpathogene Aviäre Influenza“.
Was kostet die Überwachung der AI-Impfung den Landwirt?
Dr. Christiane Soltau, Ansprechpartnerin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), erklärte den Rechtsrahmen für eine Geflügelpest-Impfung. Mit der neuen „Delegierte Verordnung (EU) 2023/361“ der EU-Kommission sei nun zwar eine Impfung möglich, aber nur mit Sondergenehmigung und unter sehr starken Reglementierungen. Grundsätzlich würden keine Lebendimpfstoffe zugelassen und es müsse eine Risikobewertung durchgeführt sowie ein Impfplan erstellt werden. Die sogenannte Notimpfung sowie eine Notschutzimpfung würden für Deutschland von vornherein wegfallen.
Nur die Präventivimpfung sei sinnvoll, solange keine Ausbrüche in dem jeweiligen Gebiet stattgefunden haben. Hier sei die Verordnung leider schwammig, denn die Frage, wie groß dieses Gebiet ausfalle, könne nicht beantwortet werden. Die Folgen der dann geltenden Verbringungsverbote (z. B. von Zuchttieren, Eiern o. Ä.) in ungeimpfte Betriebe und eine verstärkte Überwachung sollten vorab genau überdacht werden.
Solange geimpfte Tiere gehalten würden, müssten alle vier Wochen serologische Tests an 60 Tieren für die aktive Überwachung durchgeführt werden, was nach Schätzungen für einen Betrieb mit 5.000 bis 10.000 Tieren schnell 1.000 Euro pro Monat kosten könne, rechnete Soltau vor.
Wer in Europa impft gegen die Geflügelpest?
Soltau warnte davor, dem derzeitigen Eindruck zu unterliegen, dass andere Länder innerhalb Europas bereits flächendeckend impfen würden. Derzeit gebe es nämlich keinen zugelassenen geeigneten Impfstoff in der EU, erklärte die studierte Tierärztin. Mehrere Mitgliedsstaaten wie die Niederlande, Italien, Tschechien, Ungarn oder Frankreich führten lediglich Studien mit verschiedenen Impfstoffen an unterschiedlichen Geflügelspezies durch. Erste Ergebnisse stimmten zwar vorsichtig optimistisch, doch sei es noch ein weiter Weg bis zu einer EU-Zulassung eines Impfstoffes und der Handelbarkeit geimpfter Tiere und Erzeugnisse.
Seit der Vorstellung von Impfplänen in den Niederlanden, Irland und Spanien zur HPAI-Impfung in geschlossenen Betrieben sowie der französischen Pflichtimpfung für Entenbestände zur Stopfleberproduktion gebe es Sperrungen für den Export von Geflügel und derer Produkte für Länder wie Japan, die USA und Kanada, Thailand, Chile und die Philippinen. Auch Großbritannien und Korea haben Fragenkataloge bezüglich des Geflügelexports dem BMEL zugesandt.
Wie geht es auf dem Weg zur Impfung weiter?
Soltau verwies auf eine bereits existierende Stellungnahme der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit), die die derzeitige Lage zu den verfügbaren Impfstoffen und den Impfstrategien der EU darstelle. Für März 2024 werde eine weitere Stellungnahme der EFSA zur Überwachung von geimpften Betrieben und Risikominimierungsmaßnahmen erwartet.
In Deutschland wurde für die Erarbeitung der Impfstrategie und von Impfplänen eine Arbeitsgruppe der Taskforce Tierseuchenbekämpfung ins Leben gerufen. Somit stehe man am Anfang eines Prozesses, der mindestens noch ein Jahr dauern werde.