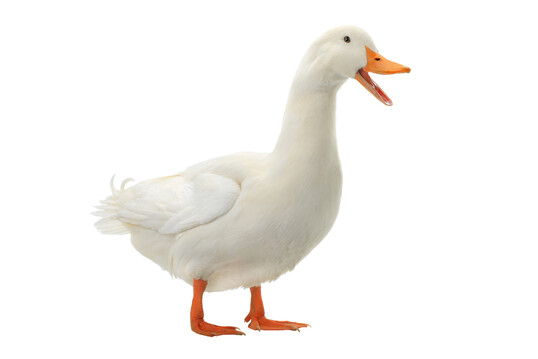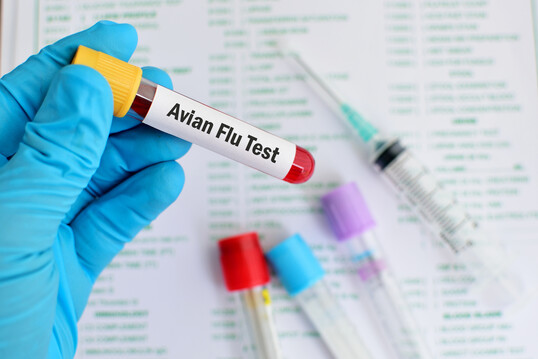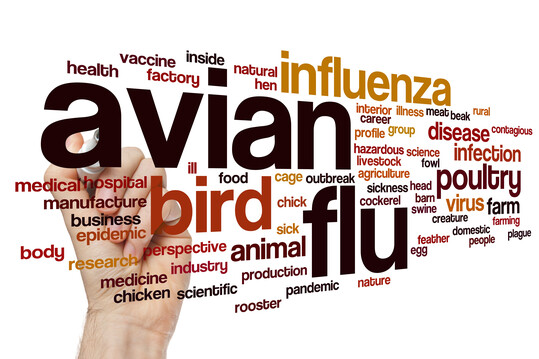Nutzen und Risiken einer Impfung von Geflügel gegen hochpathogene Aviäre Influenza
Eine Impfung gegen hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI) kann unter anderem das Ein- und Austragsrisiko in und aus Geflügelbeständen senken. Doch die Impfung ist auch mit Risiken verbunden. Deshalb muss ihr Einsatz genau geprüft werden.
- Veröffentlicht am

Die Vogelgrippe beschäftigte die Geflügelhaltung in der Vergangenheit eher saisonal. Konsequente Keulung der betroffenen Bestände mit anschließender Reinigung und Desinfektion der Ställe konnte eine endemische Situation verhindern. Doch seit 2022 haben sich die Infektionen ausgeweitet und die Viren weitere Varianten gebildet. Diese führen seither auch in der warmen Jahreszeit zu Ausbrüchen, sodass die Welttiergesundheits-Organisation (WOAH) als weitere Bekämpfungsoption nun auch die Prüfung der HPAI-Impfung empfiehlt und dies auch in ihrer jüngsten Resolution „Strategic challenges in the global control of high pathogenicity avian influenza“ (Paris, 21-25. Mai 2023) ausdrücklich dargelegt hat.
Die EU hat diese Erweiterung der Schutzmaßnahmen bereits mit dem Tiergesundheitsgesetz (2016/429) berücksichtigt und durch die EU-Verordnung 2023/361 rechtsverbindliche Normen festgelegt. Dieser Paradigmenwechsel ermöglicht Mitgliedstaaten (MS) HPAI-Impfungen unter strengen Auflagen zu nutzen, die in den spezifischen Anhängen der EU-Verordnung 2023/361 (insbesondere III-V sowie XIII) detailliert erläutert sind.
AI-Impfung: Chancen vs. Risiken
Eine mögliche HPAI-Impfung bei Geflügel eröffnet mehrere Chancen:
- Reduktion des Eintragsrisikos. Daraus ergibt sich ein erweiterter Schutz von Geflügelhaltungen mit Auslaufmöglichkeiten auch in Gegenwart eines erhöhten Eintragsrisikos aus der Umwelt/den Wildvogelpopulationen (z.B. Ausnahmen von der Stallpflicht),
- Reduktion der Virusaustrages aus infizierten Geflügelhaltungen und damit Senkung des allgemeinen Infektionsdruckes,
- Reduktion der Frequenz von HPAI-Ausbrüchen und der assoziierten Restriktionsmaßnahmen führt zu geringeren Störungen der Wirtschaftskreisläufe,
- Gemindertes Risiko der menschlichen Exposition gegenüber potenziell zoonotischen HPAIV Varianten.
Eine HPAI-Impfung ist aber auch mit Risiken und Herausforderungen verbunden:
- Die Maskierung klinischer Krankheitszeichen nach einem HPAIV Kontakt bewirkt, dass klinische Überwachungsstrategien (Syndromsurveillance) unwirksam werden und dies eine Entgleisung der HPAIV Ausbreitung begünstigen kann,
- Der durch die Impfung entstehende Selektionsdruck auf das HPAI-Virus kann die Entstehung sogenannter Escape-Varianten des HPAIV begünstigen, wodurch ggf. Anpassungen der Impfstoffe erforderlich würden.
HPAI Impfprogramme sind daher durch die EU mit umfangreichen Auflagen verbunden, die in den spezifischen Anhängen der EU-Verordnung 2023/361 (III-V, sowie insbesondere XIII) detailliert erläutert werden. Hervorzuheben ist, dass ein amtlicher Impfplan (2023/361, Art. 6) die Aufsicht der Behörde und den unbedingt erforderlichen Zeitraum definieren muss. Zudem sind Impfungen nur vorgesehen, wenn klar dargestellte Ziele – Impfstrategien (Art. 7) - definiert sind: Unterschieden werden drei mögliche epidemiologische Ausrichtungen einer HPAI-Impfung :
- Notimpfung zur Eindämmung der Ausbreitung („Notsuppressiv“; entspricht einer Riegelungsimpfung),
- Notimpfung zur Prävention einer Einschleppung bei bereits bestehenden Ausbrüchen in Geflügelhaltungen einer Region („Notschutz“) sowie die
- „Präventivimpfung“ sofern noch keine Ausbrüche registriert wurden.
Im Hinblick auf die zurückliegenden Ausbruchsituationen sind in Deutschland vor allem Präventivimpfungen als sinnvoll zu erachten, das heißt zur Verhinderung des HPAIV-Eintrages über Wildvögel in Geflügelhaltungen. Jede Form der Impfung unterliegt spezifischen Vorschriften, die eine verstärkte klinische und labortechnische Überwachung vorsehen (Art. 10) bzw. mit Verbringungsverboten für Tiere und Erzeugnissen verbunden sind (Art. 14).
Mit Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen und dem anhaltenden HPAIV-Infektionsdruck, ist davon auszugehen, dass Anfragen von Verbänden oder einzelnen Haltern nach Genehmigungen einer HPAI-Impfung an Intensität zunehmen werden. Zudem ist die Möglichkeit der Impfung bei dem hohen Infektionsdruck umso dringlicher je mehr ökologische Freilandhaltungen als präferierte Haltungsform etabliert werden.
Die erforderlichen Genehmigungsverfahren für den Impfstoffeinsatz liegen in den Händen der Mitgliedstaaten. Konkrete Pläne Frankreichs ab Herbst 2023 eine Impfung für Enten vorzubereiten, werden diese Option auch für Deutschland konkreter werden lassen. Dabei ist zu erwarten, dass verschiedene Interessengruppen unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Es erscheint insofern sinnvoll, mögliche Szenarien im Vorfeld zu erwägen und, im Sinne der Harmonisierung, mögliche Impfpläne mit den Bundesländern und Interessenverbänden abzustimmen und möglichst einheitlich zu beschließen.
Impfzulassung unter strengen Gesichtspunkten prüfen
Aufgrund der möglicherweise weitreichenden Auswirkungen auf internationale Handelsoptionen, der mangelnden Erfahrung mit den epidemiologischen Vorsichtsmaßregeln der Überwachung sowie der gegenwärtig unklaren Situation der Impfstoffzulassung, sollte eine HPAI-Impfung in Deutschland zunächst unter strengen Gesichtspunkten erwogen werden. Eine Einführung in ausgewählten Sektoren der Geflügelproduktion, vorzugsweise in außenhandelsunabhängigen Haltungen, erscheint sinnvoll.
Grundlage der Überlegungen sollte eine Abwägung des HPAI-Eintragsrisikos für Geflügelbestände im Verhältnis zu den Möglichkeiten des Bestandsschutzes durch optimierte Biosicherheit sein. Für die Beurteilung können die Ausbruchszahlen der vergangenen Jahre wichtige Hinweise geben. Dabei sollten folgende Parameter bewertet werden:
- Geflügelspezies und Nutzung: Mit einem erhöhten Risiko behaftet erscheinen Gänsehaltungen, Halboffenhaltungen (Puten in Louisianaställen) oder Freilandlegehennen.
- Verfügbarkeit von Impfstoffen mit Zulassung für die jeweilige Geflügelspezies
- Geografisches Risiko: Haltungen in Gebieten mit starker HPAI-Aktivität in Wildvögeln (küsten- und gewässernahe Bereiche) sind verstärkt gefährdet.
- Populationsdynamisches Risiko: Kompartimentierte Impfungen von Haltungen in Regionen mit hoher Dichte expositionsgefährdeter Geflügelpopulationen könnten das Eintrags- und Verbreitungsrisiko senken.
- Handelsrelevante Belange: Stehen Impfungen im Konflikt mit anderen Geschäftsmodellen der Region?
- Surveillance: Steht für die vorgeschriebene impfbegleitende Überwachung eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung bzw. könnten bei Auslastung der Kapazitäten alternative Strukturen (Tiergesundheitsdienst, Eigenkontrollverfahren etc.) genutzt bzw. geschaffen werden? Hier ist in erster Linie an die Anforderungen amtlicher Untersuchungen mit Probennahmen und labordiagnostischen Untersuchungen zu denken.
- Finanzielle Erwägungen (Kosten von Impfung und Surveillance)
- Das Auftreten von HPAIV-Stämmen mit einem hohen Zoonoserisiko kann Interventionen durch Geflügelimpfung beschleunigen.
Generell ungeeignet, auch unabhängig von den oben beschriebenen aktuellen Vorbehalten, erscheint die aktive Immunisierung kurzlebigen Geflügels (Masthühner, Mastenten), da in diesen Haltungsformen kaum impfabhängige Immunität in der Lebensspanne der Tiere (30 bis 45 Tage) induziert werden kann und die zumeist stallintensive Haltung im Rein-Rausverfahren ein geringes Eintragsrisiko birgt.
Kleinhaltungen mit gemischten Geflügelarten (Ausnahmen: geschlossene Haltungen, z.B. Zoos) würden ebenfalls den strengen Überwachungskonditionen unterliegen; aufgrund der Vielzahl solcher Betriebe und den mit der Überwachung verbundenen hohen Kosten, wären die Möglichkeiten einer Impfung in diesem Sektor mit den Überwachungsbehörden abzustimmen und den Verbänden entsprechend zu kommunizieren. Hier sollte zudem die Diskussion mit der EU-Kommission erwogen werden, um sinnvolle Erleichterungen als zukünftige Anpassungen der EU-Verordnungen abzustimmen.
AI-Entwicklung in Europa
Hochpathogene aviäre Influenzaviren (HPAIV) des Subtyps H5 haben seit zwei Jahren einen enzootischen Status in der Wildvogelpopulation Europas erlangt. Waren es seit 2006 vermehrt sporadische Einträge von HPAIV H5, wird seit 2021 das Virus in Deutschland ganzjährig und in der gesamten Landesfläche HPAI Virus in Wildvögeln detektiert. Daraus folgt eine kontinuierliche Bedrohung mit fortwährendem Einschleppungsrisiko von HPAI-Viren in Geflügelbestände. Diese geänderte epidemiologische HPAI-Situation besteht nicht nur für Deutschland und Europa, sondern hat sich zu einer globalen Panzootie entwickelt. In den vergangenen Jahren kam es daher in verschiedenen Regionen Europas und bestimmten Geflügelhaltungsformen wie Freilandhaltungen, in denen empfohlene organisatorische und physikalische Biosicherheitsmaßnahmen zum Ausschluss der Viren nicht konsequent umgesetzt werden können, zu einer Häufung von HPAI-Ausbrüchen mit erheblichen Beeinträchtigungen der Wirtschaftskreisläufe in der Geflügelproduktion. Betroffen waren aber auch Rassegeflügelhaltungen und Zoologische Gärten, deren Ausbruchsbekämpfung erhebliche Ressourcen der Veterinärbehörden gebunden haben.
Weitere Informationen zum Thema und zur aktuellen Lage in Deutschland finden Sie HIER:
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen