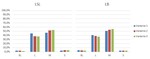Wie viel Input ist nötig?
- Veröffentlicht am

Kurz und bündig
Der schmale Grat einer nährstoffangepassten Tierfütterung, die dem Bedarf der Tiere bestmöglich entspricht und trotzdem weiter die Ausscheidungen an Stickstoff und Phosphor absenkt, wurde mit Schwerpunkt auf die Legeleistung bei den Genetiken Lohmann Selected Leghorn classic (LSL) und Lohmann Brown (LB) untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Eine Absenkung ist unabhängig von der Legelinie möglich.
Das Ziel des durchgeführten Versuchs war es, durch eine Absenkung der Stickstoff- und Phosphorgehalte (kurz: N- und P-Gehalte) im Futter die N- und P-Ausscheidungen über die Exkremente zu reduzieren. Doch ist eine Absenkung von N und P im Futter möglich, ohne die Leistungen negativ zu beeinflussen?
Eingestallt wurden Legehennen der Genetik Lohmann Brown (LB) und Lohmann Selected Leghorn classic (LSL). Für die Variante 1 wurden vier und für die Varianten 2 und 3 je fünf Wiederholungen mit jeweils 36 Tieren durchgeführt. Geprüft wurden drei Varianten der N- und P-reduzierten Fütterung. Eine Tabelle mit der genauen Zusammensetzung der einzelnen Rationen ist online einsehbar (siehe QR-Code). Zu den erfassten Parametern zählen die Leistungsparameter, die Verluste, die Eigewichtsverteilung und die Eiqualität.
Die Leistungsparameter
Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen Leistungsparameter über 13 Legeabschnitte. Bezogen auf die Durchschnittshenne hatte die Variante 2 keinen Einfluss auf die Leistungsparameter im Vergleich zur Variante 1. Bei der Variante 3 nahmen die Parameter Eizahl, Eimasse, Eigewicht und Legeleistung je Durchschnittshenne im Vergleich zur Variante 1 ab: - 7,4 Eier; - 0,7 g Eimasse; - 0,7 g Eigewicht; - 2 Prozentpunkte Legeleistung. Keine statistisch signifikanten Unterschiede ergaben sich für die Parameter Futterverbrauch, Futterverwertung und die Verluste. Auch die Genetik hatte keinen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die Leistungsparameter in diesem Versuch.
Verschiebung der Eigewichte
In der Grafik ist deutlich zu sehen, dass es durch die Absenkung der N- und P-Gehalte im Futter zu einer Verschiebung der Anteile an L-Eiern in Richtung M-Eier kam. Inwieweit diese Unterschiede statistisch signifikant sind, muss in einem weiteren Versuch überprüft werden.
Die Futtervarianten hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Eiqualität zum Ende der Nutzungsdauer. Im Vergleich der zwei Genetiken zeigte sich das typische Bild: Höhere Bruchfestigkeit der Schale bei den LB und bessere Eiklarqualität bei den LSL. Weitere Untersuchungen sind nötig, um die Eiqualität über die Legeperiode zu bewerten.
Die Nährstoffbilanzierung
Tabelle 2 zeigt, dass die aus den Leistungsdaten berechnete N- und P-Ausscheidung je kg Eimasse für Variante 1 bereits veröffentlichte Werte bestätigen konnte (vergleichbar mit der N- und P-reduzierten Fütterung nach DLG-Band 199). Während die aus den Exkrementanalysen bestimmten P-Ausscheidungen diese Werte ebenfalls bestätigten, konnten bei den N-Ausscheidungen Abweichungen festgestellt werden.
Die Abweichungen zwischen den beiden Berechnungsmethoden sind größtenteils durch die gasförmigen N-Verluste zwischen Ausscheidung und Beprobung zu erklären. Im Vergleich zur Variante 1 führte eine weitere Reduktion der Nährstoffgehalte in den Varianten 2 und 3 im Durchschnitt über LB und LSL zu einer Verminderung der berechneten N-Ausscheidungen von je 1 % und 6 %. Die berechneten P-Ausscheidungen wurden um je 9 % und 15 % reduziert.
Ergebnisse auf einen Blick
Die berechneten N- und P-Ausscheidungen für die Variante 2 reduzieren sich im Vergleich zur Variante 1 um jeweils 1 % und 9 %, ohne die Leistung negativ zu beeinflussen. Bei der Variante 3 kommt es zu Leistungseinbußen bei einer Reduzierung der berechneten N- und P-Ausscheidungen um 6 % und 15 %. Es ist abzuwägen, ob die genannte Reduzierung der N- und P-Ausscheidungen das Leistungsdefizit rechtfertigt. Hinsichtlich der Eigewichtsklassen zeichnet sich durch die Reduzierung der N- und P-Gehalte im Futter eine Verschiebung von L-Eiern in Richtung M-Eier ab. Diese Beobachtung konnte allerdings aufgrund einer zu geringen Anzahl an Wiederholungen für die einzelnen Varianten bei der Eiersortierung nicht statistisch belegt werden. Die Eiqualität am Ende des 13. Legeabschnittes hat sich durch die unterschiedlichen Futtervarianten nicht verändert.
Bei der Fütterung der N- und P-reduzierten Variante 2 konnten im Vergleich zur Variante 1 die N- und P-Ausscheidungen reduziert werden, ohne die Leistungsparameter negativ zu beeinflussen. Bei der Variante 3 nahmen die Parameter Eizahl, Eimasse, Eigewicht und Legeleistung je Durchschnittshenne im Vergleich zur Variante 1 ab. Keine statistisch signifikanten Unterschiede ergaben sich für die Parameter Futterverbrauch, Futterverwertung und die Verluste. Auch die Genetik hatte keinen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die Leistungsparameter in diesem Versuch.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen