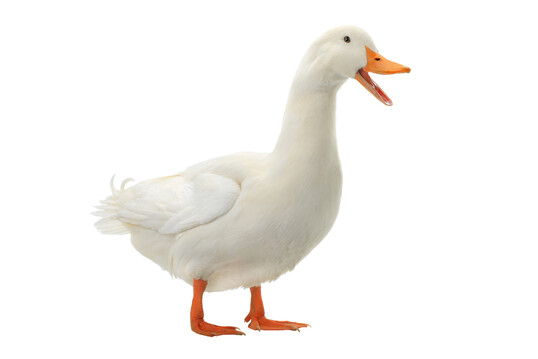Wettlauf von Virus und Impfstoff
Virusmutationen sind derzeit durch die Corona-Krise in aller Munde. Auch beim Geflügel gibt es Viren, die sich oft verändern und damit immer gefährlicher werden. Dazu gehört das Virus, das die Mareksche Krankheit hervorruft. Dessen Mutationen bereiten Geflügelproduzenten weltweit Sorgen, denn die bestehenden Impfstoffe könnten ihre Wirksamkeit verlieren.
- Veröffentlicht am

Kurz und bündig
Die Mareksche Krankheit ist weltweit eine Bedrohung für Geflügelbestände. Das Virus mutiert stark und verändert sich so in Virulenz und Pathogenität. Weitere Faktoren tragen zu einer Verschärfung der Situation bei. Neue Impfstoffe müssen entwickelt werden, die einer drohenden Virulenzsteigerung entgegenwirken können. Der Wettlauf zwischen Virusmutation und Impfstoffentwicklung ist bedeutend. Gerade ist ein neuer Impfstoff in Europa zugelassen worden.
Die Mareksche Krankheit (auch als Mareksche Lähme bekannt, Kurzform MD (Marek Disease)) ist eine nach Josef Marek benannte Viruserkrankung der Hühner sowie Puten und wurde 1907 erstmals beschrieben. Die Mareksche Krankheit ist in Deutschland eine nach Tiergesundheitsgesetz meldepflichtige Tierkrankheit, sie kommt aber weltweit vor. Die MD ist hochansteckend, kann nicht saniert werden und führt zu hohen Verlusten. Der Erreger der Marekschen Krankheit ist das Hühner-Herpesvirus 2 (Gallid alphaherpesvirus 2, GaHV-2). Das Virus kommt in verschiedenen Stämmen vor, die sich in ihrer Virulenz unterscheiden. Bei den Marekviren gibt es 3 Serotypen, davon ist Serotyp 1 der Hühnertyp, Serotyp 3 ist das sogenannte Putenherpesvirus (kommt auch beim Huhn vor). Gegen den Serotyp 2 ist derzeit in Europa kein Schutz nötig.
Hohe Verluste belasten Geflügelwirtschaft
Betroffen sind vor allem Küken und Jungtiere, ab der 13. Lebenswoche sinkt die Erkrankungshäufigkeit deutlich ab. Die Infektion erfolgt über die Luftwege sowohl durch Einatmung virusbelasteten Materials sowie durch Vektoren wie Vogelmilben, Flöhe und Zecken. Auch unbelebte Vektoren wie Hautabschilferungen, Federn, Futtermittel, Staub und Gebrauchsgegenstände spielen bei der Verbreitung eine Rolle. Infizierte Tiere scheiden das Virus ab einer Woche nach der Infektion über ausfallende Federn, den Kot und Speichel lebenslang aus. Innerhalb eines Bestandes verbreitet sich das Virus binnen weniger Wochen auf alle Tiere. Die wirtschaftlichen Schäden entstehen vor allem dadurch, dass die Tiere schon 13 Wochen im Stall stehen, fressen, und am Ende keine Eier legen, bzw. gar nicht in die Legeställe kommen, weil sie an MD erkranken. Alttiere nach der ersten Legeperiode können ohne klinische Symptome bleiben, wobei nur manche Herden in eine 2. Legeperiode gehen.
Tumore und Lähmungen als Leitsymptome
Nach der Erstbesiedlung in der Lunge kommt es zu einer Ausschwemmung der Viren ins Blut und zur Besiedlung der lymphatischen Organe wie Thymus, Milz und Bursa Fabricii. Die Bursa Fabricii ist ein sackförmiges lymphatisches Organ der Vögel, welches oberhalb der Kloake zu finden ist und eine große Bedeutung für das Immunsystem hat. In der Bursa Fabricii kommt es zu einem Schwund der Lymphfollikel, im Thymus zu einem Schwund der Rinde. Im weiteren Verlauf werden etwa 10 Tage nach der Infektion die Federfollikel, Nerven, Regenbogenhaut und Eingeweide besiedelt und es kommt zur Bildung von knotigen TLymphozyten-Ansammlungen, einer sogenannten Lymphomatose.
Das Ausmaß der Erkrankung wird auch vom Immunstatus und vorangegangenen Infektionen bestimmt. Hatte das Tier vorher Kontakt zu schwach-virulenten Stämmen, unterbleibt zumeist die Bildung der Lymphome, also der Lymphknotenvergrößerungen beziehungsweise Lymphknotenschwellungen und Tumoren des Lymphgewebes. Die Inkubationszeit variiert zwischen 20 Tagen und einem halben Jahr. Die häufigsten Todesfälle aufgrund dieser Erkrankungen fallen zwischen dem 60. und 180. Lebenstag an, denn die jungen Hühner haben sich dann bereits als Küken infiziert.
Verlaufsformen abhängig von Serotyp und Pathogenität
Die MD kann sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken, abhängig von Serotyp und Pathogenität des Virus. Ebenfalls entscheidend für den Krankheitsverlauf ist das Immunsystem der Hühner, welches von Genetik, Alter und Haltungsbedingungen abhängig ist:
- Bei der klassischen oder auch chronischen Form dominiert die Besiedlung der Nerven und es kommt zu Lähmungen bei 12 bis 16 Wochen alten Tieren, in seltenen Fällen auch zu Erblindung. Die Hühner hinken, die Zehenstellung ist verändert oder die Bewegungen sind gänzlich unkoordiniert. Auch Krämpfe und Veränderungen der Pupille gehören zum typischen Erscheinungsbild der klassischen Form. Im späteren Verlauf sind geschwulstähnliche, knotenförmige Veränderungen an den Nervensträngen der erkrankten Flügel und Beine zu ertasten. Die Symptome können alle zusammen oder aber auch jedes für sich auftreten. Die Mortalität liegt unter 10 %.
- Die akute Form tritt seuchenhaft bei Küken bis zur 8. Lebenswoche auf und führt zu Todesfällen vor allem bei 18 bis 22 Wochen alten Tieren. Es kann auch noch zu späten Todesfällen zu Beginn der ersten Legeperiode kommen. Die Mortalitätsrate beträgt bis zu 50 %. Die akute Form zeigt sich in Hauterhebungen, die zu einer rauen Haut führen, verdickten Federfollikeln sowie Lymphomen in den Eingeweiden. Die Tiere magern ab und verenden, weil in den inneren Organen wie Leber, Milz oder Lunge krebsartige Zellwucherungen entstanden sind.
- Eine weitere Form ist der immunsuppressive Krankheitsverlauf, bei dem die infizierten Tiere keine typischen klinischen Anzeichen aufweisen, jedoch aufgrund des beeinträchtigten Immunsystems extrem anfällig für Sekundärinfektionen sind. Solche Tiere scheiden Viren aus und stellen damit eine wesentliche Infektionsquelle für andere Tiere dar. Überlebende Hühner sind Virenträger und somit potenziell ansteckend für sämtliche nachfolgende Hühner. Und die Erreger selber können noch sehr lange Zeit überleben: bis zu einem Jahr auf Bruteiern, im Kot, in der Einstreu oder auch im Boden.
Da es diverse Differentialdiagnosen zu Marek in seinen einzelnen Symptomen gibt, ist der Tierarzt gefordert, einen Verdacht durch gezielte Diagnosestellung zu untermauern. Dafür eignet sich die Untersuchung von Tumormaterial, Federmaterial und häufig als Absicherung der Diagnose die Polymerase Kettenreaktion (PCR, molekularbiologisches Analyseverfahren). Eine Therapie ist nicht möglich, weshalb die Verluste weltweit gesehen immer noch sehr hoch sind. Die Bekämpfung konzentriert sich auf die Vorbeugung.
Vorbeugen durch Züchtung und Impfungen
Früher, bevor es Impfungen gab, versuchte man, über die Züchtung resistenter Rassen der Erkrankung Herr zu werden. Diese Methode funktionierte eine Weile, stieß dann aber an ihre Grenzen. Seit den 1960er Jahren gibt es Schutzimpfungen, die idealerweise am ersten Lebenstag schon in der Brüterei durchgeführt werden. Die Impfstoffe sollten deshalb am ersten Lebenstag verabreicht werden, da sie nur so früh angewendet auch den frühestmöglichen Schutz bieten. Die Impfung schützt jedoch nur vor dem Ausbruch der Symptome und nicht vor der Infektion. Die Ausscheidung des Virus über die Federfollikel ist zwar in vielen Fällen reduziert, aber immer noch vorhanden. Trotz Impfung werden also im Falle einer Feldinfektion pathogene Viren freigesetzt, die eine potenzielle Gefahr für jedes ungeimpfte Huhn am Standort sind.
Vor der Einführung von passenden Impfstoffen waren die Verluste in infizierten Beständen sehr hoch. Seit der routinemäßigen Impfung von Eintagsküken sowie einer entsprechenden Hygiene im Stall und bei der Zucht ließ sich die MD allerdings zumindest in Europa recht gut beherrschen, gelegentliche Ausbrüche kommen aber dennoch vor. Dr. Will Landman vomTiergesundheitsdienst Deventer, Niederlande, erklärte kürzlich auf einer Vortragsveranstaltung von Boehringer Ingelheim, dass noch andere Faktoren zu Ausbrüchen trotz Impfung beigetragen haben könnten. Dazu zählen die frühe Expositon der Hühner gegenüber dem MD-Virus durch mangelnde Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen bei vorheriger MD-Infektion, aber auch falsches Impfmanagement und die Verabreichung von Impfstoffen in zu geringen Dosen.
„Besonders bei Neueinstallung in Anlagen, in denen zuvor potenziell infizierte Tiere untergebracht waren, ist daher auf maximale Stallhygiene zu achten“, erläuterte Dr. Landman. „Die meisten europäischen Halter nutzen daher das „all in – all out“- Verfahren, um damit das mögliche Wirtsreservoir für das Feldvirus deutlich zu reduzieren, da alle Tiere im Bestand ungefähr gleichzeitig nach der Impfung ihre Immunität entwickeln. Zusammen mit vernünftiger Hygiene vor und nach jedem Durchgang wird somit das Infektionsrisiko minimiert.“ Wissenschaftler schauen allerdings mit Sorge in die Zukunft, denn das MD-Virus verändert sich ständig weltweit, es mutiert. In Europa befindet sich das Virus auf einer Art Plateau, die Veränderungen sind (noch) nicht ganz so stark wie in anderen Teilen der Welt. Doch Fakt ist: Über die letzten 50 Jahre sind die Krankheitssymptome immer akuter geworden und variabler in ihrer Ausprägung. Obwohl es Impfstoffe gibt, herrscht unter Geflügelhaltern deshalb schon länger die Angst, dass das Virus sich schneller verändern als die Impfstoffe angepasst werden können.
Dieser Wettlauf zwischen der Einführung neuer Impfstoffe und der Entwicklung des MD-Virus stellt eine große Bedrohung für die Geflügelindustrie dar. Besonders in Nordafrika sind die Probleme aufgrund neuer sehr virulenter Stämme derzeit groß. Prof. Nair Venugopal vom Pirbright Institute, Großbritannien, machte auf der Veranstaltung deutlich, dass es trotz der Impfung weiterhin weltweit zu unvorhersehbaren plötzlichen Ausbrüchen sowie auch zu einer steigenden Virulenz des Virus durch Mutationen kommt.
Damit verbunden ist eine nachlassende Wirksamkeit der Impfstoffe in den betroffenen Gebieten. In den letzten Jahren wurde weltweit das Auftreten von sehr virulenten (vv) und / oder sehr virulenten plus (vv+)- MD-Virus-Stämmen beobachtet. Mit diesen hochvirulenten Stämmen kamen auch neue Symptome hinzu wie Arteriosklerose, dauerhafte Immunsuppression und Tumore auch bei resistenten Hühnern sowie bei Puten. Die ständige Mutation des MD-Virus hat die Entwicklung neuer Impfstoffe oder Impfstrategien erzwungen, die die virulenteren Stämme kontrollieren sollten.
Sehr virulente Virusstämme bedrohen Impfschutz
Seit 1960 gibt es erste Lebendimpfstoffe gegen MD. Der erste großflächig eingesetzte Impfstoff war ein Herpesvirus, das aus Puten isoliert wurde (HVT, Serotyp 3). Ihm folgten weitere attenuierte, also abgeschwächte Impfstämme der Serotypen 1 und 2. Diese Kombination war wirkungsvoller als nur ein Stamm alleine. Die dritte Impfstoffentwicklung fand in den frühen 1990er Jahren statt. Seitdem wurde dem CVI988/Rispens Stamm (benannt nach Rispens), ein attenuierter Serotyp-1-Stamm, eine gute Schutzwirkung gegen vv MDV Stämme zugesprochen. Dieser Rispens-Stamm schien über eine lange Zeit zum Schutz vor den Feldviren vv und vv+ MDV der Impfstoff der Wahl zu sein.
Doch Forscher in Nordamerika berichteten vor einigen Jahren von neuen sehr virulenten vv+-Stämmen, die den durch bivaDoch Forscher in Nordamerika berichteten vor einigen Jahren von neuen sehr virulenten vv+-Stämmen, die den durch bivalente Impfstoffe (immunisieren gegen zwei Erreger) erzeugten Schutz durchbrechen konnten. Eine aktuelle Studie* aus China (siehe Kasten) zeigt, dass die neuen sehr virulenten MD-Virenstämme die Schutzwirkung der aktuellen Impfstoffe mit dem Rispens-Impfstamm herabsetzen können. Bisher sind diese Viren auf das Gebiet beschränkt, in dem sie erstmals beschrieben wurden und können dort mit den herkömmlichen Impfstoffen und Hygienemanagement kontrolliert werden. Doch die MD-Situation wird vor diesem Hintergrund weltweit gut beobachtet.
Neuer MD-Impfstoff kürzlich zugelassen
Aufgrund dieser Historie war es Zeit für einen neuen Impfstoff. Mithilfe eines neuartigen Entwicklungsprozesses hat Boehringer Ingelheim nun einen neuen Impfstoff gegen MD entwickelt. Es handelt sich um ein zellgebundenes, lebendes rekombinantes Virus der Marekschen Krankheit (MD), Serotyp 1, Stamm RN 1250. Dieser Stamm besitzt eine sehr hohe genetische Homologie zum Rispens-Stamm und soll laut der Zulassung und den erfolgten Feld- und Laborstudien auch gegen sehr virulente Marekstämme Schutz bieten, so das Unternehmen. Die Immunität ist 5 Tage nach Impfung ausgebildet. Es handelt sich um einen Brütereiimpfstoff, der in Flüssigstickstoff gelagert werden muss.
Seit 2018 ist dieser neue Lebendimpfstoff schon in den USA auf dem Markt und es wurden seitdem über 200 Mio. Impfdosen eingesetzt. Die Anwender berichten von einer gut ausgewogenen Balance zwischen Verträglichkeit und Wirksamkeit. Nun ist der Impfstoff auch in Europa zugelassen worden und soll ab Mai verfügbar sein. Zusätzlich ist eine Kombination aus dem neuen Marek-Impfstoff und dem schon bestehenden Vektorimpfstoff gegen das Putenherpesvirus (HVT, MD-3) und IBD (Gumboro) gegen die infektiöse Bursitis bzw. Gumboro zugelassen worden, so dass damit gleichzeitig zwei in der Geflügelproduktion bedeutenden immunsuppressiven Erkrankungen vorgebeugt werden kann.
Studie belegt: Wirksamkeit lässt nach
In einer chinesischen Studie wurde die Pathogenität des MDV-Stammes GX18NNM4 (vv+ MDV-Stamm), der aus einem klinischen Ausbruch in einer mit CVI988 / Rispens geimpften Broilerzüchterherde in Südchina isoliert wurde, untersucht. Im Impf-Challenge-Test konnte GX18NNM4 den durch die Impfstoffe CVI988/Rispens und 814 bereitgestellten Schutz durchbrechen. Das Virus reduzierte auch die Körpergewichtszunahme signifikant und verursachte deutliche Läsionen und einen großen Infiltrationsbereich neoplastischer Lymphozytenzellen in Herz und Leber, Bauchspeicheldrüse und weiteren Organen des infizierten Geflügels. Die Ergebnisse zeigten, dass der GX18NNM4-Stamm eine schwere Immunsuppression verursachen und den durch die aktuellen kommerziellen Impfstoffe bereitgestellten Schutz signifikant verringern kann.
- Zur Studie: The Emergence of a vv + MDV Can Break through the Protections Provided by the Current Vaccines. Meng-Ya Shi, Min Li, Wei-Wei Wang, Qiao-Mu Deng , QiuHong Li, Yan-Li Gao , Pei-Kun Wang, Teng Huang, Ping Wie. Viruses. 2020 Sep 20;12(9):1048
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen