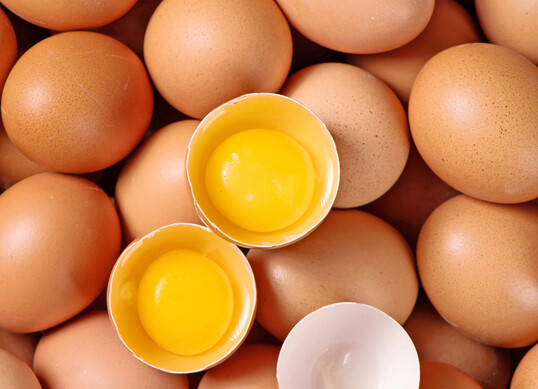Ripke: Niedersachsens Geflügelwirtschaft gestaltet Fortschritt
Anlässlich des NGW-Zukunftsforums am 29.09.2025 in Dötlingen-Altona hat der NGW-Vorsitzende Friedrich-Otto Ripke die Zukunftsziele seiner Mitglieder und die Forderungen an Politik und Handel klar formuliert.
von NGW Quelle NGW erschienen am 29.09.2025In seinem Impulsreferat auf dem Zukunftsforum betonte Friedrich-Otto Ripke, Vorsitzender des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbands (NGW), die herausragende die Rolle Niedersachsens in der deutschen Geflügelwirtschaft.
„Niedersachsen ist mit Abstand Geflügelland Nr. 1“ erläutert Ripke. Von rund 170 Millionen Masthühnern, Puten, Legehennen, Gänsen und Enten in Deutschland befinden sich etwa 106 Millionen Tiere in Niedersachsen.
Verantwortung und Kompetenz
Diese Konzentration bringe eine große Verantwortung mit sich – für Ernährungssicherung, Tierschutz, Boden- und Klimaschutz sowie für Nachhaltigkeit. „Dieser Verantwortung werden wir in unserer Branche mit sachkundigen Tierhaltern, fortschrittlichen Unternehmen, kompetenten Tierärzten und engagierten Wissenschaftlern seit Jahren konsequent und innovativ gerecht. Wir können das wirtschaftsseitig besser als Politik und Handel und wir müssen das auch, weil nur wir das Geflügel halten und zu wertvollen Lebensmitteln verarbeiten. Wir gestalten entschlossen Fortschritt und Zukunft!“ betont Ripke.
Spätestens in der Corona-Pandemie ist allen Beteiligten deutlich geworden, dass die Geflügelwirtschaft systemrelevant, kritische Infrastruktur und Herstellerin von lebenserforderlichen Gütern ist. Staat und Gesellschaft müssen sie deshalb schützen und zukunftsfähig machen.
Gemeinsame Zukunftswege gesucht
Die Nachfrage nach Geflügelfleisch und Eiern ist in den vergangenen 20 Jahren um 25 % gestiegen. Weitere 5 % Steigerung allein in den kommenden zwei Jahren werden erwartet. „Die Verbraucher bzw. der Markt ist auf unserer Seite und Politik und Handel müssen es mit verlässlichen Rahmenbedingungen auch sein! Sonst klappt es nicht mit gleichzeitiger Vollversorgung mit Lebensmitteln aus heimischem Geflügel und Tier- und Klimaschutz!“ fordert Ripke. Darüber soll auf dem NGW-Zukunftsforum gemeinsam diskutiert und nach gemeinsamen Zukunftswegen gesucht werden. Der Weg in höhere Haltungsformstufen mit seinen Vorteilen und Zielkonflikten wird dabei das Kernthema sein.
Geflügelwirtschaft in Niedersachsen als Jobmotor
Für den NGW mit seinen rund 1.600 Mitgliedern aus der gesamten Wertschöpfungskette kommt es auf Verlässlichkeit, Planungssicherheit und weniger Bürokratie an. Selbstbewusst und in Zahlen belegt stellt der NGW fest, dass die Geflügelwirtschaft in Niedersachsen, insbesondere im Nordwesten, nach Maschinen- und Automobilbau der wichtigste Wachstumstreiber und Jobmotor ist. Ihre Bedeutung nimmt aktuell eher noch zu. Davon profitieren die ländlichen Räume strukturell und die Menschen als Arbeitnehmer auch persönlich.
Vor diesem Hintergrund geht es im Detail um zukunftsfördernde Schritte und Entscheidungen in Erzeugung, Handel und Politik. In der Geflügelwirtschaft wird der Investitionsstau für Stallum- und Neubauten aktuell auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Damit diese Investitionen in gesunde Lebensmittel und mehr Tier- und Klimaschutz zur Umsetzung kommen, bedarf es positiver Rahmenbedingungen, die fördern und nicht bremsen sollen.
Forderungen des NGW
- Die Land- und Ernährungswirtschaft darf nicht weiter isoliert betrachtet werden. Mit 16 % Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und mit 47 % Umsatzanteil in der IHK Oldenburg sind sie ein relevanter Wirtschaftsfaktor.
- Das Gesetz zur Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen muss auch beim Bau von Geflügelställen das sogenannte „Tierwohlprivileg“ auslösen, wenn die Tiere nach Haltungsformstufe 2, 3, 4 oder 5 innerhalb der Initiative Tierwohl gehalten werden. Die Einhaltung der Anforderungen ist durch QS-Kontrolle nachzuweisen.
- Das rechtlich verankerte und von allen Baubehörden in Niedersachsen einheitlich anzuwendende Tierwohlprivileg muss auch bei der Umsetzung der TA-Luft zu deutlichen und praktikablen Erleichterungen beim Um- und Neubau von Geflügelställen führen.
- Deutsche Bürokratie kostet viel zu viel Zeit und Geld und kostet uns die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Sie verzögert den Fortschritt im Tier- und Klimaschutz und muss drastisch abgebaut werden. Ein wichtiger Beitrag ist die Anerkennung von wirtschaftsgetragenen, in der Geflügelwirtschaft sehr gut funktionierenden Kontrollsystemen, wie QS und KAT. Der Staat sollte sich auf die stichprobenartige Kontrolle der QS- und KAT-Kontrolle beschränken. Das würde u.a. endlich auch die personell überforderten Behörden der Landkreise entlasten.
- Flankierend zur Anerkennung des Tierwohlprivilegs bei Stallum- und Neubauten zwecks Geflügelhaltung in den HF-Stufen 2 bis 5 bei ITW und den KAT-Stufen Freiland und Bio braucht es eine planungssichere Investitionsförderung des Bundes. Die Zuständigkeit und bundeseinheitliche Abwicklung sollten bei der Rentenbank liegen, weil sonst nicht auszuschließen ist, dass einige Bundesländer voraussichtlich unterschiedlichen parteipolitischen Einfluss nehmen.
- Die Land- und Ernährungswirtschaft braucht ergänzend zur Haltungskennzeichnung von Nutztieren zwingend eine staatliche Verpflichtung zur Herkunftskennzeichnung. Sie muss alle Handels- und Verzehrswege erfassen, d.h. Direktvermarktung, Lebensmitteleinzelhandel- und Großhandel, die Gastronomie inklusive Mensen und Kantinen. Im Hinblick auf das erforderliche Label sollte eine Zusammenarbeit mit dem ZKHL angestrebt werden. Das im LEH-Markt befindliche freiwillige ZKHL-Label „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ findet aktuell schnelle Verbreitung.
- Bei der Anwendung der TA-Luft muss auch im Geflügelbereich das Tierwohlprivileg zugunsten von reduzierten Anforderungen bei der Ammoniak-Reduzierung gelten. Hier gilt es, schon seitens der zuständigen Behörden, den Zielkonflikt zwischen Tierwohlställen und Emissionsminderung eindeutig für das Tierwohl zu entscheiden.
- Höhere Haltungsformstufen sind mit geringeren Tierzahlen im Stall verbunden. Auch dies ist ein Zielkonflikt mit der notwendigen Ernährungssicherung. Die Geflügelwirtschaft ist diesbezüglich systemrelevant, kritische Infrastruktur und Herstellerin von lebenserforderlichen Gütern. Ihr Auftrag ist klar und in Zeiten großer geopolitischer Veränderungen wichtiger denn je: die Bevölkerung mit genügend gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Durch die ständig steigende Nachfrage nach Geflügelfleisch und Eiern, ohne die durch staatliche Auflagen gebremste Anpassung durch Stallneu- und Umbauten, ist das praktisch unmöglich geworden. Die Selbstversorgungsgrade sprechen hier eine deutliche und beunruhigende Sprache. Die zukünftigen Rahmenbedingungen müssen deshalb fördern und nicht fordern!
- Importe von Lebensmitteln, die nicht mindestens den deutschen bzw. EU-Standards entsprechen, müssen ausgeschlossen bleiben. Diese Standards bei der Lebensmittelsicherheit, sozialer Nachhaltigkeit, Klima- und Tierschutz müssen eingehalten und kontrolliert werden. Das gilt insbesondere für Importe aus Polen, der Ukraine und über Mercosur aus Südamerika uneingeschränkt. Wenn Mercosur aus gesamtwirtschaftlichen Gründen kommen wird, ist den diskutierten Schiedsgerichten eine klare Absage zu erteilen. Standards müssen voll gelten und dürfen nicht verhandelbar sein.
- Der Lebensmitteleinzelhandel hat neben dem Staat eine wichtige Funktion bei der Weiterentwicklung des Geflügelfleisch- und Eiermarktes. Er sollte nicht losgelöst von Tierhaltern, Verarbeitern und Verbrauchern und nicht bevorzugt und kurzfristig zu schnell auf höhere Haltungsformstufen setzen. Die aktuelle Nachfrage liegt bei HF 3 und höher gerade erst bei etwa 5 %.
Es geht um viel!
„Ohne planungs- und gewinnsichere ökonomische Rahmenbedingungen wird es weder ausreichend Hofnachfolger noch Investitionen in die Zukunft geben“ mahnte Ripke. „Die mit mehr Tierwohl verbundenen Zielkonflikte müssen klar und gemeinsam schnell entschieden werden. Es geht gerade um viel und die Zeit für richtige Entscheidungen ist knapp!“ fasste der Vorsitzende eindringlich zusammen.