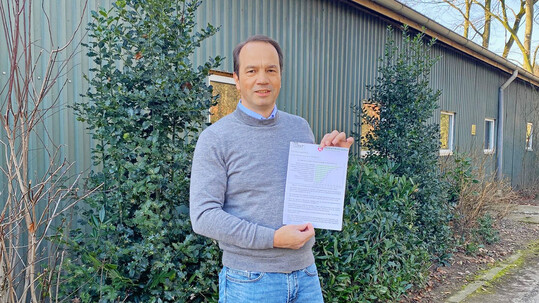Trotz aller Hürden: „Geflügelfleisch ist im Aufwind“
In den USA dürfte zum Tag des Geflügels wegen weiter grassierender Geflügelpest die Stimmung eher schlecht sein. Im Gegensatz zu deutschen Geflügelhaltern, sagt Christoph Klomburg von der neu gegründeten AG Geflügel im Landvolk Niedersachsen. Hürden wie der hohe Bürokratieaufwand und Planungsunsicherheit machen Tierhaltern allerdings hierzulande zu schaffen, wie eine Umfrage des Landvolks zeigt.
von LPD erschienen am 19.03.2025Die Seiten des Stalls sind offen, sodass immer frische Luft hineinströmt, der Boden ist dick mit Stroh eingestreut und die Puten picken an eigens dafür bereit gestellten Picksteinen oder beschäftigen sich mit den zahlreichen Strohraufen. So beschreibt der LPD, der Pressedienst des Landvolks Niedersachsen, den Putenstall von Christoph Klomburg anlässlich des „Tages des Geflügels“, der zumindest in den USA traditionell auf den 19. März fällt, auf seiner Webseite. „Das ist einfach eine schöne Tierhaltung“, fasst Christoph Klomburg aus Syke zusammen. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Mittelweser ist auch Vorsitzender der neu gegründeten AG Geflügel im Landvolk Niedersachsen. Dort wollen sich Geflügelhalter aus Niedersachsen regelmäßig austauschen, um ihre Anliegen dann in den Fachausschuss des Deutschen Bauernverbands einzubringen, in dem Klomburg ebenfalls Vorsitzender ist.
„Geflügelfleisch ist im Aufwind“
Zurzeit sei die Stimmung gut: „Geflügelfleisch ist im Aufwind“, freut sich Klomburg. Besonders Hähnchenfleisch werde zunehmend nachgefragt. Der Marktbericht des Deutschen Bauernverbands belegt diesen Trend: „Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg von 2023 auf 2024 um 1 kg auf 20,9 kg“, heißt es dort. Der Putenfleischmarkt stagnierte dagegen mit 4,6 kg pro Kopf aufgrund begrenzter Bestände. „Die Haltung der Puten ist anspruchsvoll“, sagt Klomburg, dessen Familie sich seit mehr als 30 Jahren mit den Tieren beschäftigt. Missen möchte er die imposanten Tiere auf seinem Hof trotzdem nicht. Besonders froh ist er daher auch, dass Niedersachsen in Bezug auf die Geflügelpest bislang glimpflich durch den Winter gekommen ist. „Es haben sich alle an die strengen Hygienemaßnahmen gehalten“, ist der Tierhalter erleichtert.
Klomburg beteiligt sich an der Tierhaltungsform der Initiative Tierwohl. Sie ordnet seit einigen Jahren die vorhandenen Label in mittlerweile fünf Haltungsformstufen, um dem Verbraucher ein transparenteres Kennzeichnungssystem mit weniger Labeln auf der Verpackung anzubieten. „Neben dem zusätzlichen Platz und den Außenklimareizen kommen ab diesen Sommer Strohballen als Aufsitzmöglichkeit dazu, um den Stall noch besser zu strukturieren“, plant der 42-Jährige. Dann hätten die Tiere die Möglichkeit, hochzuspringen und über das Gelände zu schauen.
„Effizienz ist gleichbedeutend mit Klimaschonung“
Weitere Schritte, die mit mehr Bauaufwand und zusätzliche Genehmigungen verbunden seien, wie ein Wintergarten oder sogar Auslauf, müssten in Ruhe abgewogen werden. „Dafür muss erst der Absatz gesichert sein“, stellt Klomburg klar. Derzeit stamme 90 Prozent des Geflügelfleischs aus Haltungsstufe 2, in Kantinen oder Restaurants werde jedoch leider meistens noch nicht die Haltungsformstufe ausgezeichnet, sodass dort zum Teil auch günstigere Importe zum Einsatz kämen.
Neben dem Wohl der Tiere ist dem Landwirt die Klimabilanz seiner Arbeit wichtig. „Das ist ein großes Pfund, mit dem Geflügelhaltung wuchern kann“, sagt Klomburg. Denn pro Kilogramm Fleisch brauchen Hähnchen und Co weniger Futter als andere Tierarten. „Effizienz ist gleichbedeutend mit klimaschonend“, lautet seine Einschätzung. Darüber hinaus ist sein Ziel, dass die Kreisläufe auf seinem Hof rund laufen. Er füttert den eigenen Weizen, streut mit dem eigenen Stroh ein und verteilt den Mist im Anschluss an die fünfmonatige Mast der Hähne und die viermonatige Mast der Hennen wieder auf seinen Äckern. Der Strom wird auf den Dächern des Stalls mittels Photovoltaikanlage produziert. „Nur bei der Wärme sind wir noch nicht autark“, bedauert Klomburg. Denn in der vierwöchigen Aufzucht wollen auch Puten es kuschelig warm haben.
Tierhaltung vor großen Herausforderungen
Allerdings steht die die Tierhaltung in Niedersachsen auch vor großen Herausforderungen, heißt es in einem weiteren Beitrag vom LPD. Dies zeige eine aktuelle Online-Umfrage, die das Landvolk Niedersachsen im Rahmen seiner Aktionen zu „tierischGUT aus Niedersachsen“ durchgeführt hat und zu der rund 1.300 Landwirte aus den verschiedenen Bereichen der Tierhaltung auswertbare Beantwortungen lieferten. „Wir setzen uns aktiv für den Erhalt und die Zukunft der heimischen Tierhaltung ein. Mit dieser Umfrage haben wir die Stimmung und Erwartungen der niedersächsischen Tierhalterinnen und Tierhalter eingefangen, denn die Tierhaltung in Niedersachsen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, erklärte Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers dazu.
Mehr als die Hälfte des landwirtschaftlichen Produktionswertes werde in Niedersachsen durch die Tierhaltung erwirtschaftet. „Unsere Betriebe stehen aber durch rechtliche Vorgaben, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Erwartungen unter Druck. Die Folge ist, dass viele Landwirte die Tierhaltung aufgegeben haben“, betont Ehlers. Die Befragungsergebnisse seien daher eine wertvolle Grundlage, um klare Forderungen an Bundes- und Landespolitiker sowie Agrarpolitiker zu stellen.
Bürokratie und Planungsunsicherheit als größte Hürden
Laut den Ergebnissen stellt der hohe bürokratische Aufwand mit 82 Prozent die größte Hürde für die Landwirte dar. Die fehlende Planungssicherheit, insbesondere in Bezug auf politische Entscheidungen, liegt mit 68 Prozent auf Platz zwei. Auch die Einhaltung der hohen gesetzlichen Haltungsvorgaben wird von fast der Hälfte der Befragten (48 Prozent) als Problem angesehen. Neben diesen Kernpunkten wurden auch Umweltauflagen, Importstandards, steigende Betriebsmittelkosten sowie die Entwicklung des Marktes kritisch betrachtet.
Auch spezifische Themen wie das Baurecht, die Rolle des Lebensmitteleinzelhandels sowie der Umgang mit dem Wolf wurden untersucht. Diese Ergebnisse sollen schrittweise veröffentlicht werden. Fachreferentin für Vieh und Fleisch beim Landvolk Natascha Henze, die die Umfrage erstellt und ausgewertet hat, sieht darin eine wichtige Grundlage für künftige Diskussionen. „Es ist essenziell, dass die Politik die Sorgen und Nöte der Landwirte ernst nimmt und Rahmenbedingungen schafft, die eine nachhaltige und zukunftssichere Tierhaltung ermöglichen“, erklärt Henze.
Das Landvolk Niedersachsen betont, dass die Umfrage nicht nur Herausforderungen aufzeigt, sondern auch Lösungsansätze liefern soll. „Wenn die Politik die richtigen Weichen stellt, hat die Tierhaltung in Niedersachsen eine Zukunft“, resümiert Ehlers, Nun liege es an den politischen Entscheidungsträgern, Maßnahmen zu ergreifen, um den Landwirten eine verlässliche Perspektive zu bieten, denn der Strukturwandel sei bei tierhaltenden Landwirten deutlich größer als in der Landwirtschaft insgesamt.