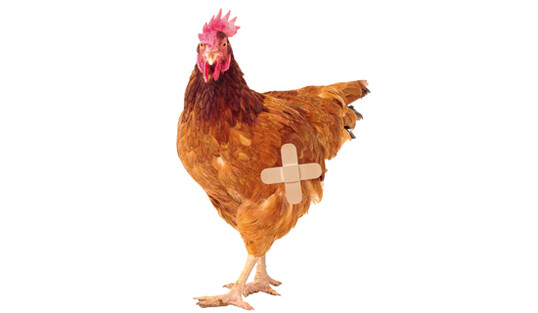Erster Tag des Zweinutzungshuhns
Traditionelle, alte Hühnerrassen stehen erstmals am "Tag des Zweinutzungshuhns" am 22. Januar 2022 im Mittelpunkt.
- Veröffentlicht am

Der Tag wurde vom Projekt "ei care" – einer Initiative der Terra Naturkost Handels KG, dem Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. und der Ökologischen Tierzucht gGmbH ins Leben gerufen, um den alten Hühnerrassen künftig mit mehr Anerkennung zu begegnen.
Diese alten Hühnerrassen zeichnen sich vor allem durch ihre im Vergleich zu den modernen Hochleistungszüchtungen größere Robustheit aus. Sie bleiben als traditionelle Zweinutzungshühner in der Leistung jedoch weit hinter den modernen Lege- und Mastlinien zurück.
Kreuzungszucht soll Wirtschaftlichkeit steigern
Im Rahmen eines dreijährigen Projekts soll die Nutzbarkeit von sechs lokalen und gefährdeten Hühnerrassen wie den Altsteirern, der Ostfriesischen Möwe oder dem Mechelner Huhn in der ökologischen Landwirtschaft untersucht werden. Aufgabe dabei ist, Kreuzungen dieser alten Rassen in der landwirtschaftlichen Praxis zu testen.
So legt beispielsweise die Altsteirer Haushuhnrasse, die in der Steiermark gezüchtet wird, höchstens 180 Eier pro Jahr – im Vergleich zu mehr als 300 Eiern, auf die ein modernes Hochleistungshuhn kommt.
„So teuer kann kein Bio-Betrieb seine Eier verkaufen, dass sich das lohnen würde“, sagt Olivia Müsseler, Geflügelexpertin bei der Beratung für Naturland, die 19 Testbetriebe koordiniert.
Die Lösung, die mit dem "Projekt RegioHuhn" gesucht wird, liegt quasi in der Mitte: Mittels Kreuzungszucht werden auf Basis der alten Rassen Zweinutzungshühner gezüchtet, die etwas mehr Eier legen oder Fleisch ansetzen – und deshalb auch wirtschaftlich für eine Haltung in der Landwirtschaft geeignet sind. Dadurch wird zugleich der Bestand der alten Rassen gesichert, weil sie für die Zucht gebraucht werden.
Nach der Zuchtarbeit folgt nun der Praxistest
Für diese Zuchtarbeit ist im Projekt das Friedrich-Loeffler-Institut für Nutztiergenetik in Mariensee (FLI-ING) zuständig, gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL/BaySG Kitzingen) und der Universität Bonn. Dort wurden zunächst die sechs alten Rassen mit Elterntieren moderner Lege- oder Mastlinien gekreuzt. Tiere aus insgesamt zwölf solchen Kreuzungen leben nun im Praxistest auf verschiedenen Naturland Betrieben.
Ganz ohne Risiko ist das für die Betriebe nicht. Denn das Fleisch und die Eier müssen sie selbst vermarkten – und wie viele Eier das sein werden, weiß noch niemand.
„Die Hähne sind jetzt im Januar alt genug zum Schlachten, die Hennen beginnen aber frühestens ab Februar mit dem Eierlegen. Dann wird es wirklich spannend“, sagt Olivia Müsseler. Bei 200 bis 250 Eiern im Jahr müsse man schon landen, darunter rechne sich das ganze wirtschaftlich nicht.
Das Projekt "RegioHuhn" wird durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft gefördert.