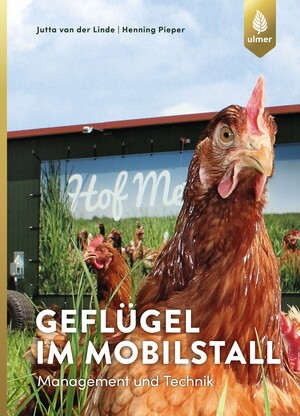Mobilstallhaltung: Lassen Sie sich im Vorfeld umfassend beraten!
Viele Mobilstallhalter sind Neueinsteiger, da ist fachkundige Beratung unerlässlich. Dr. Franca Möller vom hessischen Geflügelgesundheitsdienst gab bei einer Tagung zum Thema Mobilstallhaltung wertvolle tierärztliche Tipps, auf die Halter besonders achten sollten.
- Veröffentlicht am

In Hessen schießen Mobilstallhaltungen wie Pilze aus dem Boden, wie Dr. Franca Möller vom Hessischen Geflügelgesundheitsdienst (GGD) auf der Frühjahrsveranstaltung der Deutschen Vereinigung für Geflügelwissenschaft am 13. März 2019 in Gießen berichtete. Rund 60.000 Legehennen in Mobilställen von 58 Betrieben werden aktuell vom GGD Hessen betreut, sagt Möller, die tatsächliche Zahl Betriebe mit Mobilstallhaltung in Hessen sei gewiss höher. Ein Großteil der Halter sind Neueinsteiger, eine fachliche Beratung sei hier besonders wichtig.
Hessen fördert Beratung für Mobilstallhalter
Dabei haben es die hessischen Mobilstallhalter noch gut, denn das Bundesland fördert deren Beratung mit 1,5 Stellen über den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) und die tierärztliche Bestandsbetreuung über den GGD. Notwendig sei eigentlich eine Betreuung durch Geflügel-, Großtier- oder Gemischtpraxen mit entsprechender Sachkenntnis, findet die Tierärztin. Für diese Praxen sei aber aufgrund der weiten Fahrtstrecken und geringen Tierzahlen eine Bestandsbetreuung zu Preisen, die für Mobilstallhalter finanzierbar wären, nicht umsetzbar. „In Hessen funktioniert die tierärztliche Bestandsbetreuung aktuell nur, weil sie bezuschusst wird.“
Mobilstallhaltung: Verordnungen beachten
Erwartungen an eine tierärztliche Bestandsbetreuung gebe es wie bei den „Großen“, was beispielsweise die gesamte Palette der Geflügeldiagnostik, Therapie- und Prophylaxemaßnahmen und die Notfallversorgung angehe. „Der Punkt Salmonellenprophylaxe beschäftigt uns relativ viel. Dabei fangen wir oft an bei der Erörterung der Frage `Was sind Salmonellen?` an, schildert die Geflügeltierärztin.
Denn sobald der Bestand 350 Legehennen übersteige, was zumeist ab zwei Mobilställen der Fall ist, unterliege die Geflügelhaltung u. a. der Geflügel-Salmonellen-Verordnung. Das ist vielen Neueinsteigern in die Mobilstallhaltung offenbar gar nicht bewusst. „Allein die Anforderungen an die Biosicherheit füllt die Hälfte der Zeit unserer Einsteigerseminare.“
Geflügel-Salmonellen-Verordnung ab 350 Legehennen
Beispielsweise gibt es Untersuchungspflichten laut Geflügel-Salmonellen-Verordnung bei Betrieben ab 350 Legehennen:
- bei einem Bestand von 350 bis 999 Legehennen der Nachweis eines Qualitätssicherungssystems oder Probenziehungen (Sockentupfer/Kot)
- Ab 1.000 Tiere Probenentnahmen bei allen Herden alle 15 Wochen
- Hygieneschleuse: Möglichkeiten im Stallvorraum zum
- Umkleiden und Schuhwechsel
- zur Aufbewahrung der Kleidung (getrennt schwarz/weiß)
- Handwaschbecken
- Wasseranschluss mit Abfluss zur Reinigung und Desinfektion von Schuhen und Geräten
Geflügelpest-Verordnung gilt ab einem Huhn
Weiterhin ist ab dem ersten Huhn die Geflügelpest-Verordnung einzuhalten. Hier bestehe beispielsweise eine Impfpflicht gegen Newcastle Disease. Tierhalter gehören zu der Personengruppe, die bei Verdacht eines Seuchenausbruches dazu verpflichtet ist, diesen anzuzeigen. Relevant ist auch die Früherkennung von Geflügelpest. Konkret muss der Tierhalter laut § 4 der Verordnung bei einem Legeleistungsabfall von mehr als 5 % oder Verlusten von mehr als 2 % innerhalb von 24 Stunden in der Herde unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen von Aviärer Influenza durch geeignete Untersuchungen ausschließen lassen. Das bedeutet also, dass auch jeder Mobilstallhalter klinische Symptome von Geflügelpest bzw. Newcastle Disease kennen und Tierverluste und Eierleistungen täglich auswerten sollte.
Nach § 13 Geflügelpest-VO gibt es die Möglichkeit, auf Grundlage einer Risikobewertung die Aufstallung von Geflügel anzuordnen. Ziel ist, das Einschleppen oder Verschleppen von Geflügelpest durch Wildvögel zu vermeiden. Das lasse sich beispielsweise durch das vollständige Bespannen eines stallnahen Bereiches des Auslaufes mit Netzen mit einer Maschenweite von unter 25 mm realisieren. Bei Hennen, die täglich Auslauf gewöhnt sind, führt eine plötzliche Aufstallung zu erheblichem Stress. Wichtig sei es, sich daher frühzeitig einen Maßnahmenplan für solche Situationen zurechtzulegen. Dies umfasse auch die Beschaffung von Bau- und Beschäftigungsmaterial.
Mobilstall: Bauliche Anforderungen vorher mit planen
Bauliche Anforderungen (Aufstallungsvorsorge, Hygieneschleuse et cetera) sollten unbedingt vor dem Kauf oder Bau eines Mobilstalles mit geplant werden, betont die Mitarbeiterin des Geflügelgesundheitsdienstes. „Was brauche ich konkret und was bieten die verschiedenen Firmen an? Wenn jemand noch nie Hühner gehalten hat, ist die Beantwortung dieser Frage häufig schwierig.“
Auch sonstige Anforderungen an die Biosicherheit lassen sich relativ simpel erfüllen, zeigt Franca Möller anhand von Beispielen. So könne man einen sinnvollen Schwarz-Weiß-Bereich schaffen, indem man den Zaun um den Auslauf so spanne, dass der Stallvorraum von außen, und nicht durch eben diesen Auslauf erreichbar sei. In Bezug auf Biosicherheit warnt die Tierärztin vor dem Einbringen diverser anderer Geflügelarten in den Bestand, wie z. B. das Hinzusetzen von Rasse- oder Wassergeflügel. Zur „Abwehr“ von Greifvögeln, haben sich bislang in der Praxis Ziegen sehr gut bewährt.
Daran sollten Mobilstallhalter besonders denken
Welche Schwachstellen fallen häufig bei Betriebsbesuchen auf? Hier nennt Franca Möller folgende Punkte:
Wasserversorgung:
- Die Wasserversorgung findet in der Regel über Tanks statt, die ein bis zweimal pro Woche befüllt werden. Wie viel ein Huhn trinkt, lässt sich so schlecht evaluieren. Wichtig sind diese Informationen aber zur Trinkwasseraufnahme vor allem zur Früherkennung von Krankheiten und Störungen im Bestand. Auch technische Defekte an Tränken fallen mitunter erst spät durch einen Rückgang der Eierleistung auf.
- Kontrolle der Wasserversorgung nach dem Umstellen des Stalles: Steht der Stall waagerecht? Stimmt der Wasserdruck?
- Nachfüllen des Tanks nicht vergessen.
Technik für Impfungen und Medikamente:
- Ein Zusatzbehälter für Impfungen ist nicht überall Standard in Mobilstallhaltungen. Optimal sind entsprechende Dosiergeräte.
- Schaffung technischer Möglichkeiten, ein Medikament, Vitamine, Mineralstoffe o. ä. zu verabreichen. Ein solcher Behälter muss die Menge fassen, die die Herde innerhalb eines Tages aufnimmt. Die meisten Medikamente haben eine Stabilität im Trinkwasser von 24 Stunden und müssen täglich frisch angemischt werden.
Fütterung:
- Ist bei Trogfütterung die Füllhöhe zu hoch eingestellt, kommt es mitunter zu hohen Futterverlusten.
- Das Angebot von nur einer Futtermischung über die gesamte Legephase entspricht häufig nicht dem Bedarf der Tiere.
- Eigenmischungen sollten regelmäßig auf Inhaltsstoffe und müssen auf Salmonellen untersucht werden.
Winter im Mobilstall:
- Eingeschränkte Mobilität durch matschige Böden vor allem bei größeren Mobilställen, worunter die Auslaufqualität leidet.
- Sicherstellung der Zufahrt und Versorgung.
- Zusätzliches Beschäftigungsmaterial sollte bereitgestellt werden, da kein Aufwuchs vorhanden ist.
- Die Versorgung mit Licht über Photovoltaik kann im Winter problematisch sein, da wenig Sonneneinstrahlung: Batterien kontrollieren!
Sommer im Mobilstall:
- Möglichkeiten der Verdunklung schaffen, um vor allem bei Einstallung von Junghennen im Sommer einen guten Übergang von Aufzucht in die Legephase zu schaffen.
Krankheiten und Tierverluste:
- Tierverluste entstehen meistens durch Beutegreifer wie Fuchs, Waschbär, Habicht oder Mäusebussard. „Stellen Sie sich mit dem Jäger gut“, rät Möller deswegen. Abhilfe schaffen beispielsweise Ziegen auf der Weide, die erfahrungsgemäß ganz gut Beutegreifer wie Habichte fernhalten.
- Ekto- und Endoparasiten bekämpfen. Auch die Rote Vogelmilbe zieht es irgendwann in die Mobilställe!
- Bakterien und Viren: Hier stellt der GGD Hessen in den Mobilställen das gleiche Spektrum wie in festen Ställen fest. Bakterien: vor allem E. coli, Mykoplasmen, Gallibacterium. Viren: Infektiöse Bronchitis (IB), aktuell vor allem Stamm QX.
- Federpicken und Kannibalismus kommt auch in Mobilstallhaltungen vor. Möller bezüglich Stressvermeidung: „Wenn der Habicht ständig vorbeischaut, bedeutet das schließlich auch Stress.“
- Sachgerechte Versorgung kranker Hennen (separat von der Herde), Möglichkeiten zur Nottötung und auch die Entsorgung toter Tiere einplanen!
Und welches ist das optimale Huhn für die Mobilstallhaltung?
„Bei einer bedarfsgerechten Versorgung mit Futter und Wasser funktioniert diese Haltung auch mit Legeleistungshybriden. Der Habicht unterscheidet nicht zwischen Hochleistungstieren und Zweinutzungshühnern“, so die Antwort der Wissenschaftlerin der Universität Gießen und Tierärztin.
Fazit: Artgerechte Mobilstallhaltung nur mit Fachkenntnis
„Artgerechte Hühnerhaltung ist in Mobilstallhaltung möglich. Das beweisen die guten Betriebe. Aber dazu gehört fachliche Expertise. Ganz viel hängt auch von der baulichen Eignung der Ställe ab“, zieht Möller ein Fazit. „Den Arbeitsaufwand sollte man nicht unterschätzen. Hier sind die Eierpreise entsprechend zu kalkulieren. Was will ich als Stundenlohn ansetzen? Eine 450-Euro-Kraft ohne Fachkenntnis ist da fehl am Platz.“
Für Mobilstallhalter und Landwirte, die den Einstieg in diese Haltung planen, empfiehlt Franca Möller ausdrücklich das Buch „Geflügel im Mobilstall: Management und Technik“ von Jutta van der Linde und Henning Pieper.