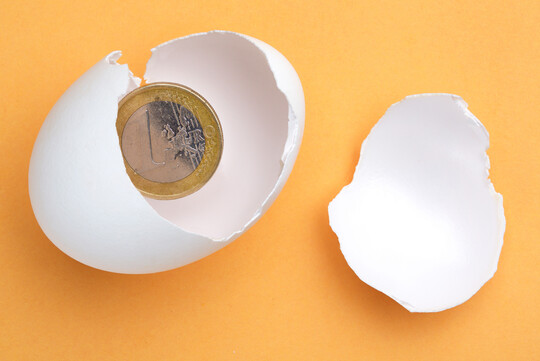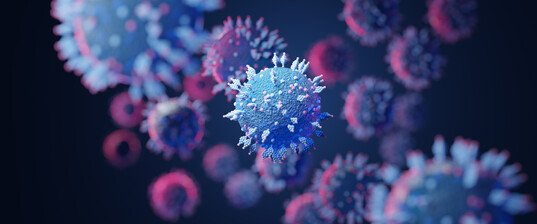Schnabelkürzen: Bei Legehennen Geschichte, bei Puten noch Praxis
Die Ursachen, die ein Kürzen des Oberschnabels notwendig machen, sind so alt wie das Geflügel selbst. Bei Legehennen fand man gute – wenn auch anspruchsvolle – Wege, diese Praxis zu beenden. Bei den Puten dauert die Suche nach praktikablen Lösungen noch an.
von DGS Redaktion erschienen am 28.10.2024Damals: Alles war erlaubt
Die Frage, die der Praxis des Schnabelkürzens bei unserem Nutzgeflügel vorangeht, ist jene nach dem bestmöglichen Weg, um Verhaltensweisen wie Federpicken und Kannibalismus bei Geflügel zu unterbinden. Verschiedene Experten aus der Geflügelbranche bestätigen, dass diese sogenannten Unarten bereits in der Antike zuerst beobachtet und auch beschrieben wurden. In Baldamus‘ „Handbuch der Federviehzucht“ von 1876 steht im Kapitel „2. Das Federausziehen“ beschrieben, dass „das sicherste Mittel zur Ausrottung der jedenfalls ansteckenden Unart (…) indes die sofortige Entfernung aller damit behafteten Individuen und in größeren Züchtereien das Schlachten derselben“ bleibt.
Im „Kalender für Geflügelzüchter“ von 1933 wird die Beimischung von frischem Blut in die Tränke als wirksames Heilmittel gegen das Federfressen empfohlen. Im selben Abschnitt wird betont, dass nur wenige Mittel zuverlässig gegen diese Unart helfen, gegen die „selbst unsere ältesten Praktiker“ zu kämpfen hätten.
Schließlich findet sich in „Spezielle Pathologie der Geflügelkrankheiten“ von Gratzl und Köhler, erschienen 1968 im Enke Verlag, folgender Vorschlag: „Zu den einfacheren operativen Maßnahmen (…) gehört das Anlegen eines Ringes aus Aluminiumdraht über den Oberschnabel, dessen Enden in die Nasenlöcher gesteckt werden (…). Von vielen Züchtern wird auch das Kürzen des Oberschnabels vorgenommen (…). Der Oberschnabel wird um etwa 2 bis 3 mm gekürzt. Man verwendet dazu meist eine Art Thermokauter (electrical debeaker).“ Damit lässt sich belegen, dass die Praxis des Schnabelkürzens schon viele Jahrzehnte alt ist – und die Beobachtung von Federpicken und Kannibalismus noch viel älter.
Heute: Tierwohl steht im Fokus
Grundsätzlich ist das Schnabelkürzen laut § 6 des Tierschutzgesetzes verboten. Die Legehennenhalter in Deutschland unterzeichneten daher bereits 2015 eine freiwillige Vereinbarung, aufgrund derer seit 2017 bundesweit auf das Einstallen schnabelbehandelter Jung- und Legehennen verzichtet wird. Die Maßnahme wird allerdings erlaubt, wenn „der Eingriff im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung zum Schutz der Tiere unerlässlich ist“.
In der konventionellen Putenhaltung ist das Schnabelkürzen daher noch immer gängige Praxis. Zwar gibt es, ähnlich wie bei den Legehennen, auch in der Putenbranche eine freiwillige Vereinbarung zum Ausstieg. Allerdings sind sich Wissenschaft und Praxis bisher einig, dass ein solcher Ausstieg aus verschiedenen Gründen deutlich herausfordernder ist als bei Legehennen. Puten sind beispielsweise wesentlich agiler und neugieriger als Hühner.
Zudem werden in der Putenmast auch die männlichen Tiere aufgezogen, bei denen es nicht selten zu Rangkämpfen kommt. Hier dient der spitze Schnabel regelrecht als Waffe, mit der sich die Tiere schwere Verletzungen zufügen können. Mittel- bis langfristig soll jedoch an dem Ziel festgehalten und auch bei Puten der Ausstieg realisiert werden. Dafür wird aktuell viel geforscht, unter anderem in verschiedenen Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert werden.