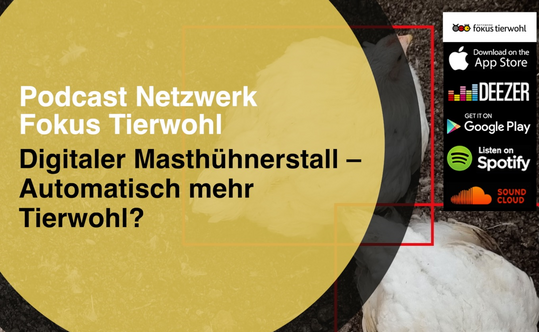Was Hühner wirklich wollen
Digitale Systeme versprechen, Tiergesundheit kontinuierlich zu überwachen und Probleme früh zu erkennen. Doch nicht jede Technik bedeutet automatisch mehr Tierwohl – und Landwirte bleiben skeptisch.
von DGS Redaktion Quelle ModernPoultry erschienen am 21.08.2025Wie das Fachmagazin ModernPoultry berichtet, steht die Geflügelhaltung vor einem tiefgreifenden Wandel: Sensoren, Kameras und künstliche Intelligenz sollen helfen, Tierwohl und Produktivität gleichzeitig zu verbessern.
Die emeritierte Oxforder Verhaltensforscherin Marian Stamp Dawkins sieht darin große Chancen, weist aber auch auf Risiken hin. Systeme könnten das Verhalten der Tiere kontinuierlich überwachen, Krankheiten früh sichtbar machen und so den Medikamenteneinsatz verringern. Ein Beispiel ist OpticFlock, das Bewegungsmuster einer ganzen Herde mit einfachen Kameras analysiert. Bereits in der ersten Lebenswoche konnte das System Abweichungen feststellen, die späteren Krankheiten oder Fußballenproblemen vorausgingen.
Doch Technologie allein ist keine Garantie für besseres Tierwohl. Größere Bestände mit weniger menschlichem Kontakt sind ebenso möglich – mit Folgen, die in der Öffentlichkeit kritisch gesehen werden könnten. „Wir müssen klare Maßstäbe schaffen, um sicherzustellen, dass Technik den Tieren tatsächlich nützt“, mahnt Dawkins.
Bislang wird Tiergesundheit häufig erst im Nachhinein anhand von Schlachtbefunden beurteilt. Lebende Tiere werden meist nur bei aufwendigen Audits kontrolliert – punktuell, subjektiv und mit hohem Arbeitsaufwand. Neue Systeme versprechen dagegen eine kontinuierliche, objektive Messung. Damit könnten Landwirte nicht nur schneller reagieren, sondern auch die Entwicklung einer Herde Tag für Tag verfolgen
Bedürfnisse sichtbar machen
Neben der Gesundheit ist die zweite entscheidende Frage für das Tierwohl: Haben die Tiere, was sie wollen? Technologie kann helfen zu verstehen, welche Bedürfnisse die Tiere haben und wie sie Emotionen zeigen. Damit lassen sich Haltungsumgebungen entwickeln, die ihren Vorlieben entsprechen.
Früher wurden dazu stundenlange Videoaufnahmen ausgewertet – heute können Daten automatisch und quantitativ erfasst werden, etwa zur Nutzung von Ressourcen oder zu sozialen Interaktionen. So lässt sich beispielsweise untersuchen, ob Broiler Sitzstangen möchten, welche Form sie bevorzugen, ob sich das Verhalten zwischen Hähnen und Hennen oder je nach Alter oder Tageszeit unterscheidet.
„Das ist ein tierzentrierter Ansatz: Das Tier zeigt uns, was es als angenehm empfindet und was es als stressig, langweilig oder beängstigend erlebt“, sagt Dawkins.
KI kann künftig alle Einflussfaktoren – Laute, Bewegungen, Gewicht, Beleuchtung usw. – gleichzeitig auswerten und Empfehlungen ableiten. Sie könnte Betriebe vergleichen, Best-Practice-Modelle herausfiltern, problematische Vorgehensweisen identifizieren und sogar Standards auf nationaler oder internationaler Ebene setzen. „Wir haben hier gerade erst begonnen“, betont Dawkins. „Entscheidungen könnten auf Grundlage einzelner Betriebe oder riesiger Datenmengen getroffen werden. Datenmenge wird kein Problem sein – aber Datenqualität bleibt entscheidend.“
Akzeptanz bei Landwirten
Ob diese Technik sich jedoch durchsetzt, hängt stark von den Landwirten ab. Laut ModernPoultry zeigt eine weltweite McKinsey-Umfrage aus dem Jahr 2024 fünf zentrale Punkte:
- Landwirte nutzen Agrartechnologien – aber nur zögerlich.
- Akzeptanz hängt vom nachweisbaren wirtschaftlichen Nutzen ab – und dieser wird noch nicht gesehen.
- Hohe Kosten schrecken ab.
- Technik muss leicht installierbar und einfach bedienbar sein.
- Kurzfristige Vorteile müssen klar erkennbar sein.
Dawkins bringt es auf den Punkt: „Wenn wir die Bedürfnisse der Landwirte nicht berücksichtigen, wird die Technik nicht genutzt – und dann profitiert auch das Tier nicht.“ Dawkins ist dennoch optimistisch: Technologien könnten ein echtes Win-Win schaffen – für Tierwohl und Gesundheit ebenso wie für die Produzenten.
Geringere Sterblichkeit bedeuten weniger Verluste und mehr vermarktbare Tiere. Weniger Verletzungen münden in besserer Qualität und effizienterer Aufzucht und weniger Krankheiten benötigen einen geringeren Medikamenteneinsatz.
„Wir müssen die Win-win-Szenarien betonen“, so Dawkins. „Nur dann kann Technologie vom Versprechen zur Realität werden.“