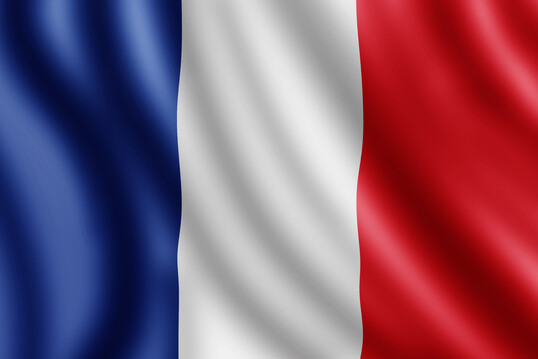Geflügelpest: Woher kommt H5N1?
Woher kommt das aktuell in Geflügelhaltungen grassierende HPAI-Virus H5N1? Welche Maßnahmen sind jetzt wichtig? Wie hoch ist die Gefahr der Ansteckung von Säugetieren und dem Menschen bei uns? Die DGS hat dazu Prof. Dr. Martin Beer befragt. Er ist Leiter des Instituts für Virusdiagnostik und Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI).
von Die Fragen stellte Susanne Gnauk, DGS Quelle FLI erschienen am 11.11.2025DGS: Wie hoch ist bei uns die Gefahr, dass sich Säugetiere wie Katzen oder Kühe anstecken? Beer: Katzen sind empfänglich für eine Infektion mit Geflügelpestviren, können schwere Krankheitsverläufe entwickeln und auch daran versterben. Ein Infektionsrisiko besteht für Katzen, wenn sie Kontakt zu infizierten Wildvögeln haben, also beispielsweise Freigänger in entsprechend betroffenen Gebieten. Bisher ist uns allerdings für das seit Anfang September laufende Geflügelpestgeschehen kein Infektionsfall bei einer Katze bekannt (Stand 10. November 2025). Das FLI schätzt das Risiko der Infektion von Wiederkäuern mit in Europa vorkommenden HPAI H5-Viren für Deutschland als sehr gering ein. Spezifische Schutzmaßnahmen für Wiederkäuer-haltende Betriebe sind derzeit in Deutschland nicht erforderlich. Dennoch ergibt sich die Notwendigkeit, im Rahmen von Ausbruchsuntersuchungen auch andere als Geflügel gehaltene Säugetiere in betroffenen Betrieben zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere Wiederkäuer und Schweine sowie Haus- und Begleittiere wie Hunde und Katzen. Bei Wiederkäuern sollte bei Mastitiden unklarer Ursache eine Untersuchung der Milch erfolgen, um eine mögliche Infektion mit hochpathogenem aviären Influenzavirus (HPAIV) auszuschließen. DGS: Biosicherheitsmaßnahmen sind oberstes Gebot. Welche Maßnahmen sind da aktuell besonders wichtig oder neu hinzugekommen? Beer: Es ist insgesamt wichtig, die Biosicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu kontrollieren und strikt einzuhalten! Insbesondere die Vermeidung eines direkten und indirekten Kontaktes zu Wildvögeln und deren Ausscheidungen sind wichtig. Hierbei spielen für den indirekten Kontakt kontaminierte Gerätschaften, Schuhwerk, Einstreu und Futter eine Rolle. Ein weiterer Baustein ist die Früherkennung. Bereits einzelne erkrankte oder verstorbene Tiere sollten auf Geflügelpest untersucht werden.
„Das derzeit auftretende HPAIV H5N1 ist eine Variante der Virusstämme, die seit 2020 intensiv in Europa bei Wildvögeln zirkulieren.“ Prof. Dr. Martin Beer, FLI
DGS: Wie steht das FLI zu Impfungen gegen AI von Geflügel? Beer: Aus unserer Sicht kommt eine Impfung besonders für bestimmte Geflügelarten und Produktionszweige in Frage. Langlebiges Geflügel, etwa Enten und Gänse, und der Sektor Freilandhaltung fallen hierunter. Auch für die besonders empfänglichen Puten kann eine Impfung diskutiert werden. Für Masthähnchen dagegen eignet sich die Impfung nicht. Wichtig ist dabei, dass die Impfung allein nicht die Lösung des Problems ist. Sie kann andere Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen lediglich begleiten und ist immer mit einem hohen Aufwand verbunden (Maßnahmen wie Impfkampagnen, gezielte Überwachung und Handelsbeschränkungen). DGS: Wie hoch ist die Gefahr bei uns, dass sich Menschen infizieren können? Beer: Für die allgemeine Bevölkerung besteht ein geringes Infektionsrisiko, denn für eine der seltenen Infektionen ist ein intensiver Kontakt zu infiziertem Geflügel oder infizierten Wildvögeln nötig. Personen, die betroffene Geflügelhaltungen räumen oder tote Wildvögel bergen und entsprechenden Kontakt haben, haben ein moderates Infektionsrisiko und müssen geeignete Schutzkleidung tragen. Hierzu gehören neben einem Schutzanzug auch Einmalhandschuhe, Schutzbrille und eine FFP3-Atemschutzmaske sowie desinfizierbares Schuhwerk. DGS: Wie hoch schätzt das FLI die Pandemiegefahr ein? Beer: Das FLI schätzt die Pandemiegefahr als gering ein. Für den Menschen besteht prinzipiell ein Infektionsrisiko durch hochpathogene aviäre Influenzaviren. Sie gelten als zoonotisch, wobei unterschiedliche Virusstämme und -linien unterschiedlich ausgeprägte zoonotische Eigenschaften haben. Das Risiko der Allgemeinbevölkerung für die aktuell in Europa und den USA dominierenden H5N1-Viren der Klade 2.3.4.4.b. wird vom ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) als gering eingeschätzt. Daher ist eine Pandemie durch diese Virenstämme im Moment eher unwahrscheinlich, sie sind nach wie vor in erster Linie auf Vögel als Zielspezies spezialisiert. Eine Exposition von Menschen muss dennoch mit allen Mitteln abgewendet werden. Daher gilt es, Ausbrüche in Geflügelhaltungen zu verhindern und infizierte tote Wildvögel sachgerecht aus der Umwelt zu entfernen. Letzteres hilft auch bei der Vermeidung von Infektionen von Säugetieren (Aasfressern wie Fuchs, Marder, Marderhund etc.). Solche Infektionen geben dem Virus die Chance Säugetier-Anpassungen zu entwickeln.
„Biosicherheitsmaßnahmen sind regelmäßig zu kontrollieren und strikt einzuhalten!“ Prof. Dr. Martin Beer, FLI
Gerade im Kampf gegen die Geflügelpest rücken Biosicherheitsmaßnahmen in den Fokus. Mehr Informationen finden Sie HIER.