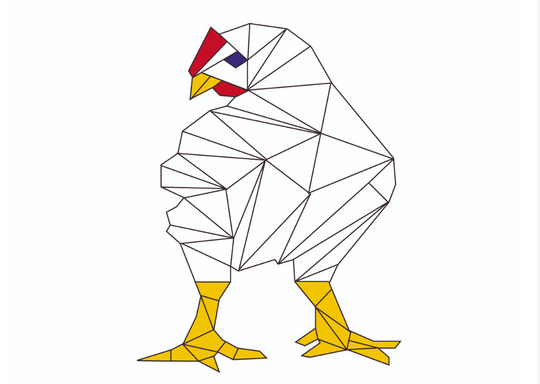Wandel in der Masthühnerhaltung: Von Intensiv bis Bio
Seit Beginn der 2000er Jahre wurde die Haltung von Masthühnern neu gedacht: Außenklimabereiche, Strukturelemente und Beschäftigungsmaterial sollten Teil der Haltungsumwelt werden.
von Kathrin Iske, DGS Redaktion erschienen am 16.08.2024Damals: Intensiv und wirtschaftlich
Erst in den 1960er-Jahren wurde die Hähnchenproduktion in Deutschland aufgebaut, seit 1970 lag der Anteil der Erzeugung immer über der 50 %-Marke. Die Hühnermast vor der Jahrtausendwende erfolgte in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern der EU ausschließlich in Bodenhaltung auf Einstreu. Hierzu wurden in der konventionellen Mast vorwiegend geschlossene Ställe mit Zwangslüftung (Unterdruck) genutzt.
Die in den 1980er Jahren vermehrt gebauten offenen Ställe (Naturstall, Louisiana-Stall) mit natürlicher Lüftung hatten sich unter hiesigen Klimabedingungen, insbesondere bei der Haltung größerer Herden, nicht bewährt. Charakteristisch für die intensive Masthühnerhaltung in der EU waren und sind Besatzdichten von etwa 33 kg LG/m² und Stallhaltung.
In den weltweit verbreiteten intensiven Produktionssystemen erfolgte die genetische Selektion der Hühner auf eine effiziente Futterverwertung – in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vervierfachte sich die Wachstumsrate der Tiere.
Heute: Alternative Haltungsformen
Seit Beginn der 2000er Jahre gibt es neben der konventionellen Erzeugung von Geflügelfleisch in Großbetrieben in vielen EU-Ländern verschiedene alternative Masthuhnproduktionen. Diese entstehen häufig durch öffentlichen Druck von NGOs – wie beispielsweise die Europäische Masthuhn-Initiative, die von der Albert Schweitzer Stiftung ins Leben gerufen wurde.
In der EU werden schätzungsweise 90 % der Masthühner in intensiver Stallhaltung aufgezogen, rund 5 % in einer weniger intensiven Stallhaltung, bis zu 5 % in Freilandhaltung und 1 % in ökologischer Haltung. Die Freiland- und Öko-Haltung weisen dabei niedrigere Besatzdichten und Zugang zu einem Außenbereich auf. Alternative Haltungsformen werden oft mit langsam wachsenden Genetiken kombiniert.
In Deutschland wurde eine Haltungsform-Kennzeichnung im April 2019 von der Initiative Tierwohl (ITW) eingeführt. Die Einstufungen von 1 bis 5 zeigen die Haltungsform an – von Stufe 1 Stallhaltung bis hin zu Stufe 5 Bio. Für jede einzelne Stufe sind die Kriterien wie Besatzdichte, Auslauf oder Beschäftigungsmaterialien klar definiert. Wie alternative Haltungsformen verschiedener Label in die Kennzeichnung eingeordnet werden, erfährt man unter haltungsform.de. Allerdings ist auch deren prozentualer Anteil an der Gesamtproduktion, ähnlich wie in der EU, noch gering.