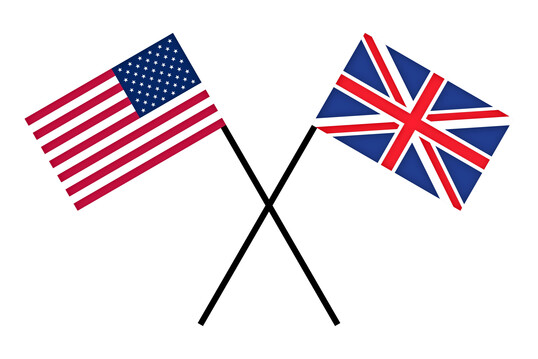Thünen-Studie empfiehlt Abbau der Nutztierbestände
Eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts für Marktanalyse behauptet, dass die gesamtwirtschaftlichen Folgen eines drastischen Abbaus der Tierbestände in Regionen mit intensiver Viehaltung emöglicherweise weniger dramatisch sei als bisher angenommen.
- Veröffentlicht am

In dem Projekt ReTiKo untersucht das Thünen-Institut die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen einer möglichen Reduzierung der tierischen Produktion in Regionen mit besonders intensiver Viehhaltung. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Landkreise des Westfälischen und des Oldenburger Münsterlandes und legt nahe, dass der zu erwartende Beschäftigungseinbruch im Veredlungssektor durch ein verstärktes Wirtschaftswachstum in anderen Branchen teilweise oder sogar vollständig kompensiert werden könne. Die Forscher sprechen sich gegen Maßnahmen zur Erhaltung der traditionellen Viehwirtschaft aus, da sie die Anpassungsfähigkeit der restlichen Wirtschaft negativ beeinflussen könnten.
"Maßnahmen zur Strukturerhaltung der herkömmlichen Viehwirtschaft sollten vermieden"
Die Studie betont in ihrem Abschlussbericht die Notwendigkeit einer umfassenden Umstrukturierung der Wertschöpfungsketten in der regionalen Tier- und Fleischwirtschaft. Sie legt nahe, dass etablierte Unternehmen ihre Geschäftsmodelle rechtzeitig an den bevorstehenden Wandel anpassen müssen, während gleichzeitig neuen und innovativen Akteuren unternehmerische Freiheit gewährt werden sollte.
Hingegen könnten politische Eingriffe, die darauf abzielen, die bestehenden Strukturen zu erhalten, die Erneuerung und Anpassung der regionalen Wirtschaft behindern und langfristig zu Einkommensrückgängen und Arbeitsplatzverlusten führen. Die Studie hebt hervor, dass eine Verringerung der Tierhaltung in viehdichten Regionen die Konkurrenz zwischen verschiedenen Branchen mildern und das regionale Beschäftigungswachstum trotz Verlusten im Viehsektor nur minimal beeinträchtigen würde.