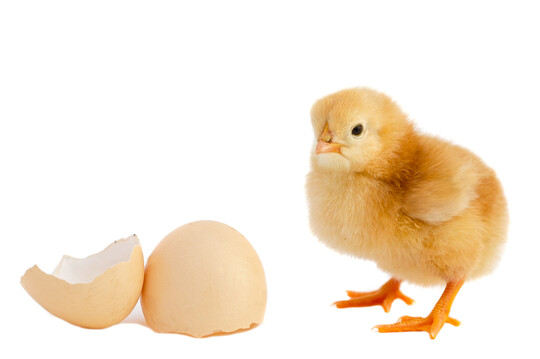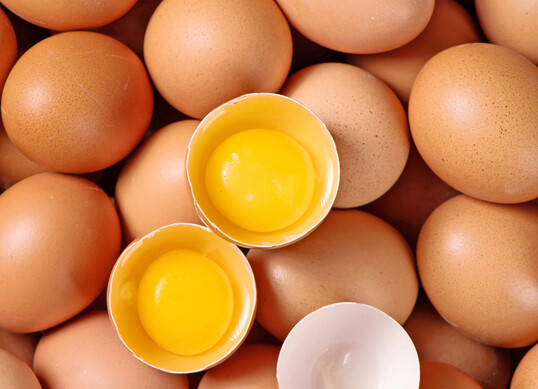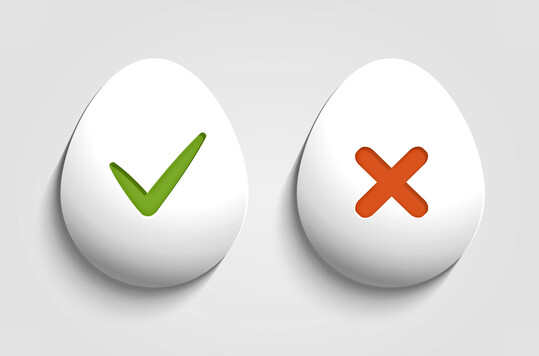Österreich: Kükentöten und echter Tierschutz passen doch zusammen
Wie gelebter Tierschutz und ein bundesweites Verbot des Kükentötens zusammen gehen, schildert der österreichische Geflügelgesundheitsdienst QGV im Bericht zur Branchenvereinbarung "Futterküken".
- Veröffentlicht am

Seit dem 1. Januar 2022 ist das Töten männlicher Eintagsküken der Legelinien – also jene Praxis, die im Volksmund kurz als „Kükentöten“ bezeichnet wird – per Gesetz verboten. Das bedeutet: Kein lebender, männlicher Bruder einer Legehenne, der als gesundes Tier aus dem Ei geschlüpft ist und nicht zu Versuchszwecken dient, darf direkt im Anschluss in Deutschland getötet werden. So weit, so verständlich.
Schon bevor die oben genannte Änderung des Tierschutzgesetzes rechtskräftig wurde, pochte der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG) immer wieder auf eine EU-weite, einheitliche Regelung dieser Praxis, um die Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten deutschen Kette der Eiererzeugung – von der Brüterei bis hin zum Legehennenhalter – zu sichern. Bisher blieb die einheitliche Regelung allerdings aus. Und das Verbot, die Bebrütung eines Hühnereies mit einem männlichen Embryo nach dem 13. Bebrütungstag abzubrechen bzw. dieses Küken nach dem Schlupf zu töten, wurde mit dem 1. Januar dieses Jahres rechtskräftig.
Verbot garantiert keinen Tierschutz
Was das Verbot für die Brütereien bedeutet, wird einmal mehr mit einer Meldung des WDR verdeutlicht: Am 6. Mai 2023 veröffentlichte das Onlineportal des Nachrichtensenders eine Meldung, aus der hervorgeht, dass drei Brütereibetriebe aus Nordrhein-Westfalen die männlichen Legeküken ins Ausland exportieren. „Eine dieser drei Brütereien gibt an, dass die Hähne im Ausland getötet werden“, teilte ein Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit.
Österreich beschliesst einen Kompromiss
Der Blick zum Nachbarn zeigt: Es geht auch anders. Der „Bericht Branchenvereinbarung ‚Futterküken‘ 2022“ der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV), der bundesweit tätige Geflügelgesundheitsdienst, thematisiert u.a. die Änderung des Tierschutzgesetzes in Österreich, in dessen § 6 nach Abs. 2 folgende Absätze 2a und 2b eingefügt wurden:
- (2a) Das Schreddern von lebendigen Küken ist verboten. Ebenso ist das Töten lebensfähiger Küken verboten, sofern diese nicht der Futtergewinnung dienen. Dieser Verwendungszweck ist jederzeit auf Verlangen von der Brüterei der Bezirksverwaltungsbehörde nachzuweisen.
- (2b) Im Falle einer Anwendung einer Methode zur Früherkennung des Geschlechts während der Brut und der Aussortierung von Küken im Embryonalstadium ist dies ab dem siebenten Bebrütungstag nur mit Betäubung erlaubt. Nach dem 14. Bebrütungstag ist die Aussortierung verboten.
Warum reine Verbote des Kükentötens zum Problem werden
Im Hinblick auf das rechtskräftige Verbot in Deutschland und Frankreich, wo das Kükentöten seit dem 1. Januar 2023 verboten ist, skizziert der QGV zum einen die Problematik dieser Verbote: In Deutschland führt es dazu, dass
- jene Futterküken, die von deutschen Verwendern benötigt werden, nun aus anderen Ländern importiert werden müssen. Die Versorgungsproblematik ist so gravierend, dass es laut dem österreichischen Bericht Planungsüberlegungen für Importe aus Asien und Übersee gibt;
- viele kleinere Brütereien den Betrieb einstellen mussten, weil die Technik zur Geschlechtsbestimmung im Ei schlicht zu kostenintensiv ist (siehe oben);
- zudem muss ein Teil der Junghennen, die in Deutschland zur Eiererzeugung und Remontierung alter Herden benötigt werden, nun quer durch Europa zu den deutschen Legebetrieben transportiert werden.
Die Schlussfolgerungen der Branchenvereinbarung des Nachbarlandes sind klar: Mit der Änderung bzw. Ergänzung des österreichischen Tierschutzgesetzes wird
- gesetzliche Klarheit geschaffen,
- die Entsorgung von getöteten, gesunden Eintagsküken über die Tierkörperbeseitigung abgeschafft und
- eine Bereitstellung von Futterküken mithilfe einer zentralen Datenbank für Brütereien und Abnehmer unter bestmöglicher Vermeidung internationaler Transporte sichergestellt.
- So wird ökologisch sinnvoller Tierschutz gewährleistet.