Fütterung
Vom Mikrobiom zum Mehrwert
Fütterung, Wasserqualität und Stallmanagement beeinflussen das Mikrobiom entscheidend. Praktische Strategien zeigen, wie Landwirte die natürlichen Abwehrkräfte ihrer Tiere stärken können.
- Veröffentlicht am
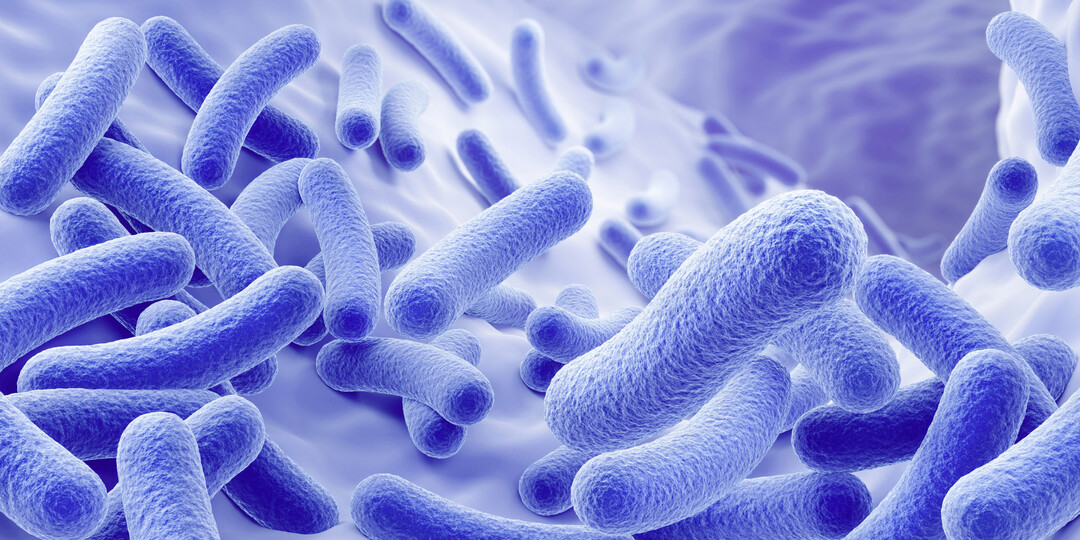
Der gesellschaftliche Druck, Antibiotika in der Tierhaltung zu reduzieren, ist hoch. Gleichzeitig stehen konventionell und biologisch wirtschaftende Landwirte vor der Herausforderung, leistungsfähige Herden professionell zu managen und wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Antibiotikafreie Geflügelhaltung ist kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von Management und Hygiene sowie Fütterung und Wasserqualität. Hygiene vor und in dem Stall als Basis Bereits vor dem Einstallen entscheidet sich, wie stabil die Gesundheit der Herde sein wird. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion des Stalls, inklusive aller Wasserleitungen und Fütterungsanlagen, ist Grundvoraussetzung. Rückstände von Einstreu, Futter oder...





