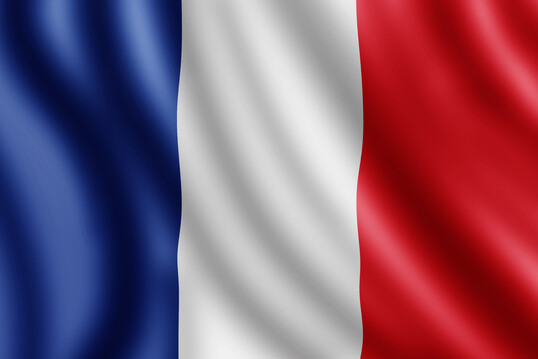Frühwarnung durch aktive Überwachung von Wildvögeln
Aktive Programme zur Überwachung der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) bei Wildvögeln gelten als aufwendig, können sich jedoch auszahlen. Frühzeitige Nachweise in scheinbar gesunden Beständen ermöglichen gezielte Gegenmaßnahmen. Darauf weist eine Fachbiologin des US-Landwirtschaftsministeriums in einem UN-Dialog hin.
von DGS Redaktion Quelle WattPoultry erschienen am 11.09.2025Die aktive Überwachung von HPAI bei Wildtieren ist ressourcenintensiver als die passive Erfassung, bei der hauptsächlich tote oder kranke Vögel beprobt werden. Dennoch sei sie ein wichtiger Baustein im Seuchenmanagement, erklärte Krista Dilione, Wildtierseuchen-Biologin beim US Department of Agriculture (USDA), während eines globalen Dialogs zur Vogelgrippe, den die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am 9. September organisierte. Darüber berichtet WattPoultry.
Dilione betonte, dass aktive Überwachung auch kosteneffizient gestaltet werden könne und langfristig Vorteile biete, die die Anfangsinvestitionen übersteigen. Entscheidend sei, dass durch die frühzeitige Erkennung von HPAI Ausbrüche schneller kontrolliert, eingedämmt oder verhindert werden können. Frühwarnungen in Wildbeständen könnten aufwendige Notfallmaßnahmen vermeiden. Zudem lieferten sie Daten, die politischen Entscheidungsträgern evidenzbasierte Beschlüsse ermöglichen.
Gezielte Stichproben statt flächendeckender Beprobung
Aktive Überwachung bedeute nicht, dass sämtliche Wildtierbestände gleichermaßen untersucht werden müssten, erklärte die Biologin. Stattdessen nutze das USDA modellbasierte Verfahren, die Risiken räumlich und zeitlich gewichten. Dazu werden Wassereinzugsgebiete als Grundeinheiten betrachtet und ökologische, räumliche sowie zeitliche Faktoren analysiert. Überwachungsmaßnahmen konzentrieren sich anschließend auf die 25 % der Regionen mit den höchsten Risikowerten.
Nach Angaben von Dilione ist diese Methode in den USA seit Jahren etabliert und hat sich als zuverlässig erwiesen. So gelang es im Dezember 2021, die ersten HPAI-Fälle in den Vereinigten Staaten bei Vögeln festzustellen, die im Rahmen dieses Programms in vorrangigen Gebieten beprobt worden waren. Damit konnte das Ziel eines funktionierenden Frühwarnsystems für die Geflügelwirtschaft erreicht werden.
Ergebnisse und Lerneffekte
Seitdem haben Überwachungsteams HPAI bei rund 7.000 äußerlich gesunden Wildvögeln nachgewiesen – etwa die Hälfte aller Wildvogelfunde während des laufenden Ausbruchs. Diese Ergebnisse machten saisonale Veränderungen erkennbar, die wiederum halfen, Zeiträume mit erhöhtem Risiko für Nutztiere genauer zu bestimmen. Darüber hinaus werden die gewonnenen Sequenzdaten in zahlreichen Studien zu Virusübertragung und -veränderung genutzt.
Mit Blick auf das H5N1-Virus sprach sich Dilione für eine Fortsetzung der aktiven Überwachung aus. Haupttreiber der Ausbreitung seien nach wie vor Wasservögel wie Enten, Gänse und Watvögel. Andere Arten, darunter Greifvögel, Zaunkönige oder auch Säugetiere, gelten eher als Endwirte ohne wesentliche Rolle in der Weitergabe des Virus.
Die Expertin wies zudem darauf hin, dass sich das Virus laufend verändere. Nur durch die kontinuierliche Beobachtung dieser Entwicklungen könnten geeignete Biosicherheitsmaßnahmen, Ausbruchsreaktionen und Impfstoffe gezielt weiterentwickelt werden.