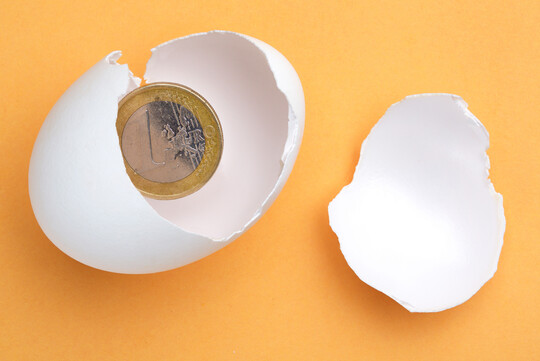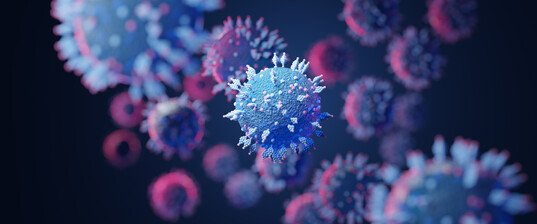
Verbot der antibiotischen Leistungsförderer
Seit Mitte der 1990er Jahre häuften sich Diskussionen um den Einsatz antibiotischer Leistungsförderer in der Tierfütterung. Nach dem endgültigen EU-weiten Verbot der Verwendung von Antibiotika als Wachstumsförderer, stehen heute der One-Health-Ansatz und die Minimierung von Antibiotikaresistenzen im Vordergrund.
von Anja Nährig erschienen am 10.07.2024Damals:
Nachdem Antibiotika (AB) in den 50er Jahren industriell hergestellt werden konnten, ging es anfangs um eine sinnvolle Verwertung der proteinreichen Pilzmyzelien, die dabei entstanden. Die Verfütterung dieser Fermentationsprodukte mit AB-Rückständen führte zu Verbesserungen der Mastleistung der Tiere. Mit diesen Erkenntnissen wurden AB zunehmend als Wachstumsförderer in der Nutztierhaltung eingesetzt. Der rasch zunehmende Einsatz der AB in der Medizin und in der Landwirtschaft zeigte aber auch bald seine Nachteile: die Anzahl AB-resistenter Bakterienstämme nahm zu.
Als in den 70er Jahren Erkenntnisse zur Übertragbarkeit von AB-Resistenzgenen vorlagen, wurden Forderungen laut, dass AB, die beim Menschen verwendet werden oder die auf Kreuzresistenz gegen diese selektieren, nicht als Leistungsförderer eingesetzt werden sollten.
Im Mai 1995 verbot Dänemark das Glykopeptid-AB Avoparcin als Leistungsförderer, Deutschland folgte im Januar 1996, die gesamte EU im April 1997. Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wurde von der EU-Kommission der weitere Einsatz der AB Virginiamycin, Tylosin, Spiramycin und Zink-Bacitracin verboten. Die Verwendung der noch verbliebenen Substanzen Flavomycin, Avilamycin sowie Monensin und Salinomycin war noch bis 2005 in Ländern der EU zulässig.
Quellen: Antimikrobielle Leistungsförderer – Rückblick und Alternativen, Prof. Dr. Dr. Marcel Wanner, Universität Zürich (1999); Zum Verbot von Antibiotika als Leistungsförderer in der Tiermast – eine Zwischenbilanz, RKI Berlin (2003)
Heute:
Mehrere Jahrzehnte schon werden keine Antibiotika mehr als Leistungsförderer in der Tierernährung eingesetzt. Menschen und Tiere leben jedoch in einer gemeinsamen Umwelt und Antibiotika werden bei beiden eingesetzt. Daher ist das Thema Antibiotikaresistenz ein wichtiges gemeinsames Thema für die Human- und Veterinärmedizin. Seit 2011 werden jährlich in Deutschland die Abgabemengen der Tierärzte für Antibiotika erfasst. Seit 2023 sind alle Mitgliedstaaten der EU nach Art. 57 der Europäischen Tierarzneimittelverordnung (VO (EU) 2019/6) dazu verpflichtet. Eine interaktive Datenbank ermöglicht spezifische Datenabfragen für bestimmte Länder oder Wirkstoffe.
Dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge haben sich die Antibiotika-Resistenzraten des Indikatorkeims E. coli bei Masthähnchen und Puten in den vergangenen Jahren verringert. Monitoringzahlen von 2023 zeigen, dass sowohl die Zahl der Behandlungstage je Tier als auch die Menge der insgesamt eingesetzten Antibiotika 2022 erneut rückläufig waren. Allerdings zeige sich, dass nicht jeder geringere Antibiotikaeinsatz unmittelbar zu Verbesserungen führe. Weltweit wird seit 2008 eine One-Health-Strategie zur Verringerung der Risiken von Infektionskrankheiten an der Schnittstelle zwischen Tier, Mensch und Ökosystem entwickelt, in der auch der Bereich Antibiotikaresistenz enthalten ist.
Quellen: DGS, RKI, BfR