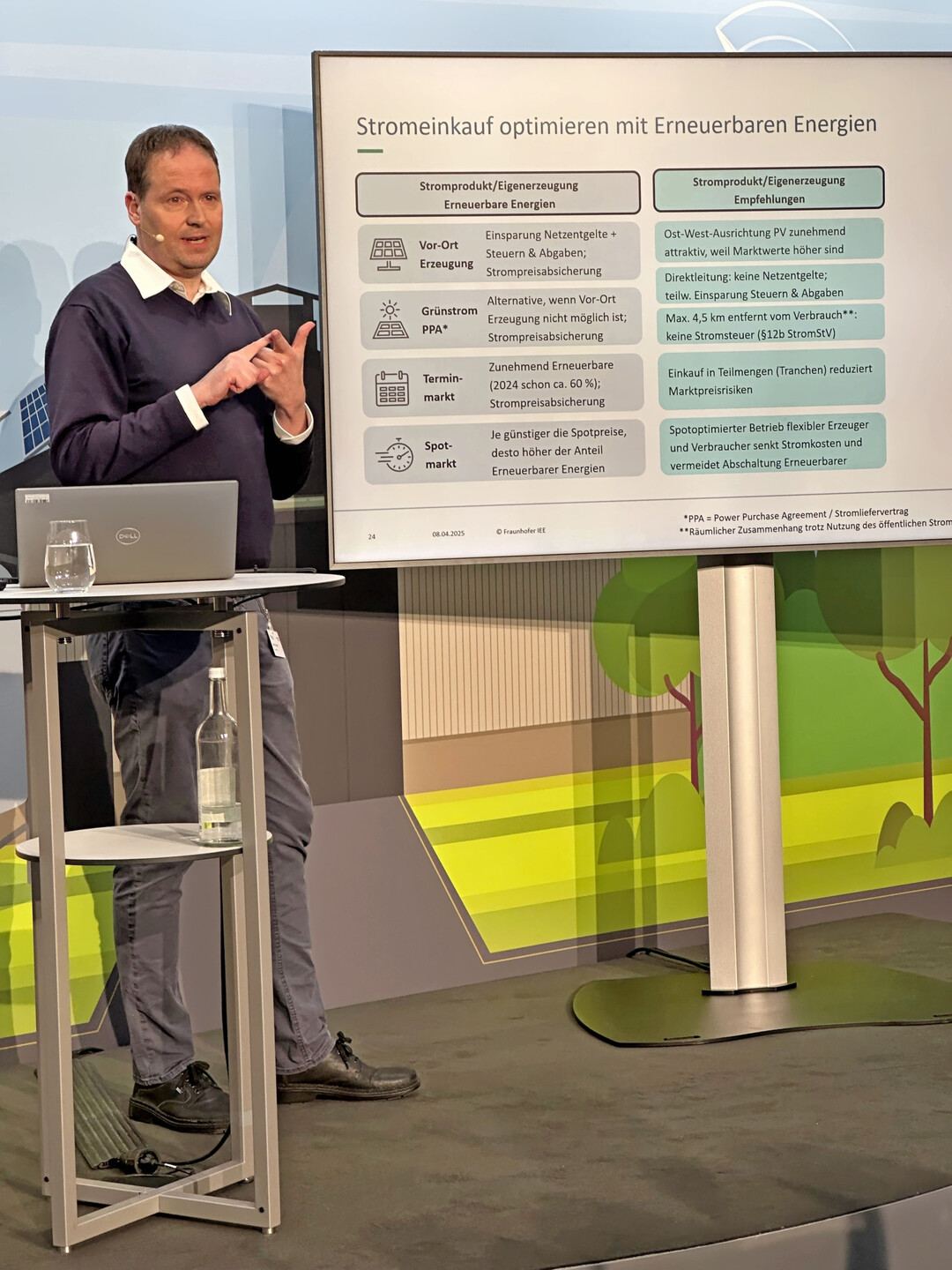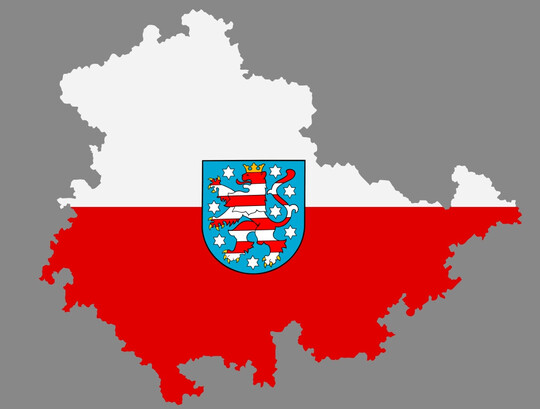Geflügelfleisch: Gesund und gut für die Umwelt
Entgegen dem allgemeinen Fleischtrend ist Geflügelfleisch auf Wachstumskurs. In Deutschland wird Geflügel zudem besonders nachhaltig erzeugt. Das wurde auf dem Deutschen Geflügel Forum 2025 am 8. April in Berlin deutlich.
von Susanne Gnauk, DGS erschienen am 09.04.2025Verändertes Konsumverhalten bei Fleisch, Standards fu¨r die CO2-Bilanzierung, die Kreislaufwirtschaft, Ressourcen- und Energienutzung – beim ersten Deutschen Geflügel Forum am 8. April in Berlin mit knapp 200 Gästen aus der Branche, der Politik, der Wissenschaft und den Medien zeigte die deutsche Geflügelwirtschaft mit diesen diskutierten Themen ihre Stärken: die nachhaltige Erzeugung eines Trendsetters. Denn Geflügelfleisch ist bei einem insgesamt schrumpfenden Fleischverzehr voll im Trend.
„Geflügelfleisch ist gesund und hat eine gute Umweltbilanz“, bekräftigte Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), in seinen einleitenden Worten. Gleich zu Beginn diskutierte er zusammen mit Moderatorin Astrid Frohloff, Peter Wesjohann, Vorsitzender Bundesverband Geflügelschlachtereien und Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe, Ernährungsberaterin Juli Resch und Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach zum Thema „Konsumwende beim Fleisch?“.
Bei der Jugend ist Geflügelfleisch im Trend
Peter Wesjohann untermauerte den Trend hin zu Geflügelfleisch mit Zahlen: Auf Basis von MEG-Daten liege der Gesamtfleischverbrauch in Deutschland bei etwa 68 kg und sei seit 2023 um etwa 9 kg zurückgegangen, der von Geflügelfleisch dagegen gestiegen – allein im letzten Jahr um 700 g auf 20,6 kg. Und das alles frei von staatlicher Unterstützung, betonten Wesjohann und Goldnick.
Besonders die junge Generation schätzt Geflügelfleisch. Juli Resch, der bei Instagram vor allem eine sehr junge Community folgt, begründet dies unter anderem mit dem Fitnesstrend. Die Influencerin sieht sogar einen Trend weg von veganer Ernährung. Geflügelfleisch sei sehr mager, reich an wertvollen Proteinen, gut verdaulich und vor allem auch gut verträglich bei Unverträglichkeiten. Wesjohann fügte weitere Vorteile an: Geflügelfleisch kann vielfältig hergestellt werden und es lassen sich damit auch leicht Convenienceprodukte herstellen. Etwa 1,5 kg Futter für die Erzeugung von 1 kg Fleisch seien im Vergleich zu Rind- und Schweinefleisch unschlagbar gut. Etwa 70 % der CO2-Belastung kommen aus den Rohstoffen des Futters, weswegen Geflügelfleisch eine gute Ökobilanz vorweise. „Ein steigender Geflügelfleischverbrauch bei sinkendem Fleischverbrauch ist auch gut fürs Klima“, fasste der Geflügelfleischverarbeiter zusammen.
Wirtschaft überlegt eigenes Gastro-Label im Sommer
Die Blackbox sei aber immer noch das Gastrogewerbe, kritisierte Wesjohann. „Hier weiß der Verbraucher immer noch nicht, woher das Geflügelfleisch kommt. Wir fordern daher eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auch in diesem Bereich“, bekräftigte der Vorsitzende des Bundesverbandes Geflügelschlachtereien. „EU-Länder wie Frankreich oder Schweden machen das bereits!“ Sollte die Politik diesbezüglich nicht tätig werden, werde die Wirtschaft selbst ein Gastro-Label im Sommer auf den Markt bringen, kündigte er an. Außerhalb Deutschlands sei man nicht wettbewerbsfähig. „Dafür haben wir zu hohe Standards in der Produktion. Das meiste Fleisch wird im Gastrobereich konsumiert.“ Der hohe Standard zeige sich allein bei der Besatzdichte: Während in der EU bei Hähnchen immer noch 42 kg je m2 gelten, liege der Wert in Deutschland bei 39 kg und für Ware der Haltungsstufe 2 der Initiative Tierwohl im Einzelhandel nur bei 35 kg je m2.
Forderungen an die neue Regierung
Wesjohann forderte in der Diskussion von der neuen Regierung, das Genehmigungs- und Umweltrecht so zu gestalten, dass Ställe um- und neu gebaut werden können. „Das ist nicht gegeben. Wir brauchen Planungssicherheit über einen langen Zeitraum. Ich hoffe hier auf die neue Koalition.“ ZDG-Präsident Goldnick forderte eine „Entfesselung der Märkte von Bürokratie. Poller aufbauen, ja, innerhalb der die Wirtschaft aber freiere Entscheidungen treffen kann.“
„Wir brauchen alles an Protein“
Weltweit, so zeigte Rubach auf, liege Geflügelfleisch mittlerweile in einigen Erdteilen an erster bzw. zweiter Stelle in der Proteinversorgung, so in Amerika und Ozeanien. Auch Asien und Afrika würden hier aufholen. „Global gesehen schaffen wir die Proteinversorgung gerade bei einer weiter steigenden Bevölkerungszahl nicht allein mit pflanzlichen Produkten wie Hülsenfrüchten“, ordnete der Ernährungswissenschaftler ein. „Wir brauchen alles an Protein. Der Geflügelfleischkonsum wird auch künftig wachsen, in Deutschland und weltweit noch mehr“, so seine Prognose.
1Einheitlicher Standard für CO2-Bilanz gefordert
„Wir brauchen eine Datenbank mit harten, validen Fakten für die Ökobilanz“, unterstrich ZDG-Präsident Goldnick. Dass ein einheitlicher Standard für die CO2-Bilanz nötig ist, darin waren sich auch die Teilnehmenden des zweiten Panels einig: Moderatorin Astrid Frohloff diskutierte das Thema mit Thomas May, QS Qualität und Sicherheit GmbH, Kristin Swoboda vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Theile Funke, Geschäftsführer Brüterei Weser-Ems und Dr. Hyewon Seo vom Umweltbundesamt (UBA). Bisher fehlt ein einheitlicher Standard bei allen Tierarten, um vergleichbar und vollständig die CO2-Bilanz von der Haltung, Fütterung und Schlachtung der Tiere bis hin zum Transport des Lebensmittels zu bewerten. Daten für die Geflügelfleischerzeugung gebe es verschiedene in der Beratung und Literatur. Die Geflügelwirtschaft selbst habe aber bereits bessere Werte berechnet auf Basis der Schlachtung und der aktuelleren Bedingungen in der Haltung, unterstrich Theile Funke.
Bei der QS GmbH werde derzeit ein einheitliches Modell erarbeitet, erklärte Thomas May. Für die Schweinemast sei man da so gut wie fertig, parallel werde am Modell für Milchkühe gearbeitet, Rindermast und Geflügelfleisch sollen zeitnah folgen. Gefragt, ob so ein Wert verpflichtend werde, sagte Kristin Swoboda vom BMEL, dass man dazu erst einmal einen einheitlichen Standard benötige. Auch das UBA unterstützt einen wissenschaftlich basierten Standard für Fleisch genauso wie für andere Lebensmittel. Eine klimafreundliche Ernährung müsse die planetaren Grenzen berücksichtigen, bei der bereits heute sechs von neun überschritten würden, betonte Seo. Sie wies darauf hin, dass der Aufwand für die Bemessung gerecht verteilt werden müsse.
Brüterei-Geschäftsführer Funke sprach von einem hohen bürokratischen und finanziellen Aufwand für die Betriebe, die hier unterstützt werden müssten. Für einen einfacheren Datenaustausch sollten intelligente digitale Systeme dienen, so May. Bestimmte Werte sollten wiederholt messbar sein. Das müsse solch ein Standard erfüllen, so Funke.
Mehrwert und Widerspruch zum Tierwohl
Und worin liegt der Mehrwert so eines Standards? Für May in der Transparenz und Belastbarkeit der Daten für eine Ökobilanz. Funke ergänzte, dass Banken und Versicherungen bereits vereinzelt danach fragten. „Verbessern können wir uns innerhalb der Branche auch nur, wenn eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass diese Verbesserung endlich ist. Eine Lebensmittelerzeugung ohne CO2-Produktion wird es nicht geben“, fügte er hinzu.
Diskutiert werden müsste allerdings auch die Gegensätzlichkeit von Tierwohl und CO2-Abdruck, darauf wurde mehrfach von Branchenvertretern hingewiesen. Besatzdichtenreduzierung und reduziertes Wachstum (langsamer wachsende Rassen – ein Thema in der Geflügelproduktion) würden sich negativ auf den Abdruck auswirken.
Der neue Branchentreff der deutschen Geflügelwirtschaft kam bei den Beteiligten sehr gut an und soll auch künftig ein Mal jährlich als Bühne für einen Austausch mit Politik, Medien und Wissenschaft dienen, kündigte ZDG-Präsident Hans-Joachim Goldnick zum Schluss an.
2