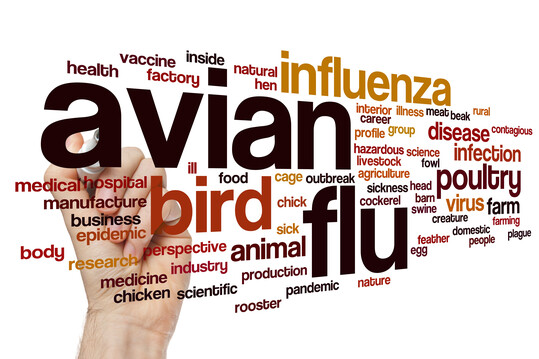Woher stammen die AI-Viren? Wo treten Sie auf?
- Veröffentlicht am
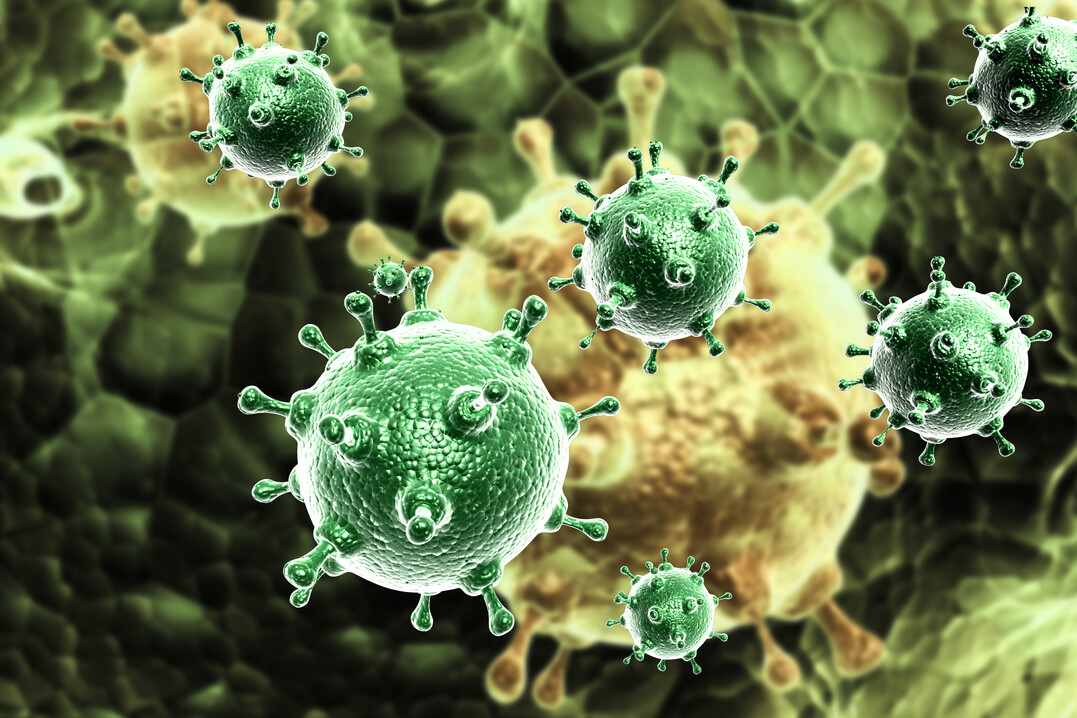
Es lassen sich 16 HA-Subtypen und neun NA- Subtypen bei Vögeln unterscheiden. Diese Viren sind normalerweise niedrig pathogen (im Englischen: low pathogenic = LP), das heißt, sie verursachen in der Regel keine oder nur milde Erkrankungen. Sie kommen in verschiedenen HA/NA Kombinationen überwiegend bei sowohl wilden Wasservögeln (Anseriformes) als auch Möwen, Seeschwalben und Watvögeln (Charadriiformes) vor, die als das natürliche Reservoir für alle Viren der HA-Subtypen 1-16 und NA-Subtypen 1-9 gelten.
Virussausscheidung vorzugsweise über den Darm
Die Infektion und die Virusausscheidung erfolgen vorzugsweise über den Darm. Mit dem Kot wird z. B. von Wildenten massenhaft Virus ausgeschieden, sodass es zur Verunreinigung von Oberflächenwasser oder Weidebereichen kommt. Durch die orale Aufnahme von mit Virus kontaminiertem Wasser oder Futter infizieren sich andere Vögel. Auf diese Weise können insbesondere im Herbst, wenn sich Wildvögel in großen Zahlen sammeln, Infektketten entstehen und Viren zwischen Vogelgruppen unterschiedlicher Herkunft ausgetauscht werden.
Direkte oder indirekte Übertragung möglich
Durch direkten Kontakt zwischen Wildvögeln und Geflügel (meist in Freilandhaltungen, wenn die Art der Haltung das Anlocken von wilden Wasservögeln erlaubt) oder indirekten Kontakten kann das Virus in eine Geflügelhaltung eingetragen werden. Indirekte Kontakte können neben kontaminiertem Oberflächenwasser als Tränke oder im Auslauf der Personenverkehr, Futtertransport, technische Einrichtungen (z. B. Transportfahrzeuge, Einstreuwagen) oder Gegenstände (Eierkartons) darstellen.
In empfänglichem Geflügel kann sich das Virus anpassen und unerkannt zirkulieren. Innerhalb einer hohen Dichte von empfänglichen Vögeln vermehrt sich das Virus schnell. Wenn es sich um ein H5- oder H7- Virus handelt, kann es sich aus seiner ursprünglich gering pathogenen Form in ein schwer krank machendes (hochpathogenes) aviäres Influenza Virus (HPAIV) verändern (mutieren).
Klassische Geflügelpest
HPAIV verursachen beim Geflügel die Klassische Geflügelpest. Der Zeitpunkt einer Mutation zu HPAIV ist nicht vorhersagbar. HPAIV können spontan sofort nach der Übertragung auf Geflügel entstehen oder erst, nachdem die gering pathogenen Vorläuferviren für einige Zeit in Geflügelbeständen zirkulierten (Jones et al., 2012); in vielen Fällen kam es auch nicht zu einer solchen Mutation. Im Falle einer Mutation des Virus, d. h. im Falle eines Ausbruchs der Klassischen Geflügelpest, werden von den infizierten Tieren große Mengen Virus ausgeschieden.
Bei einem Geflügelpestausbruch kommt es bei galliformen Geflügelarten (Puten und Hühner) innerhalb kurzer Zeit zu schwerwiegenden Verlusten, wobei die Sterblichkeit bei 75-100% liegt (Swayne und Suarez, 2000). Bei Enten und Gänsen hingegen kann die Geflügelpest wegen des möglichen Ausbleibens der schweren Symptome längere Zeit unentdeckt bleiben und sich dadurch weiter ausbreiten.
Bei einer Exposition gegenüber einer hohen Virusdosis können einige AIV-Stämme (z. B. HPAIV H5N1 und H5N6, LPAIV H7N9 in China, von dem vor kurzer Zeit auch eine für Geflügel hochpathogene Form entdeckt wurde) auf den Menschen übertragen werden und dabei eine gefährliche Infektion auslösen, die oft tödlich verläuft.
Aufgrund des segmentierten Genoms von Influenza A-Viren können sich bei gleichzeitiger Infektion eines Wirtes mit verschiedenen Influenza A-Viren neue Viren bilden, bei denen einzelne der acht Segmente der Erbsubstanz ausgetauscht sind (Reassortierung). Solche Viren können plötzlich völlig neue Eigenschaften (Virulenz, Wirtsspektrum etc.) haben. Daher besteht ein permanentes Risiko der Entstehung neuer AIV, welche nicht nur auf den Menschen, sondern auch effektiv zwischen Menschen übertragen werden können, wenn verschiedene Influenzaviren gleichzeitig zirkulieren (Lam et al., 2010).
Im Jahr 1996 entstand bei Gänsen in Hongkong ein HPAIV vom Subtyp H5N1 (goose/Guangdong/96), welches zu Ausbrüchen bei Geflügel und 18 humanen Infektionen, 6 davon mit tödlichem Ausgang, führte. Dieses Virus veränderte sich über die Jahre stetig durch Mutation und Reassortierung. Es kann mittlerweile in mindestens zehn Verwandschafts-Gruppen aufgeteilt werden. Einige dieser so genannten „Kladen“ konnten sich nur in bestimmten Regionen etablieren, während sich andere zum Teil weltweit ausbreiteten.
Impfungen von Geflügel gegen HPAI H5, Lebendgeflügelmärkte und die extensive Haltung von Wassergeflügel mit einer Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten zu wilden Wasservögeln ermöglichen die Entstehung von neuen HPAI H5 Viren in großen Gebieten Südostasiens. Seit 2003 hat diese Entwicklung global zu einem massiven Anstieg von HPAI-Ausbrüchen geführt (Guan und Smith 2013; Lee et al., 2016).
Dabei ist die mögliche Entstehung eines sogenannten pandemischen Virus, also eines, welches sich von Mensch zu Mensch über mehrere Kontinente ausbreiten kann, besorgniserregend und wird von entsprechenden Arbeitsgruppen genau beobachtet. Unabhängig von der Gefahr der Entstehung von Viren, die für den Menschen gefährlich sind, verursachen HPAIV schwere Verluste in der Geflügelwirtschaft.
Von Asien nach Europa gekommen
In der Zeit von 2005 bis 2008 gelangten asiatische HPAIV des Subtyps H5N1 (Klade 2.2) erstmals nach Europa und Afrika. Während es in Europa und Westafrika nur zu zeitlich begrenzten Epidemien kam, bei denen auch Wildvögel betroffen waren, konnte sich dieses Virus in Ägypten bis heute endemisch festsetzen und fortentwickeln, ohne dass derzeit Aussicht auf eine erfolgreiche Bekämpfung besteht.
Zwischen 2008 und 2013 breitete sich auch HPAIV H5N1 der Klade 2.3.2.1(c) transkontinental nach Europa, auf die arabische Halbinsel und nach Afrika aus. In Europa verursachten Viren dieser Klade nur vereinzelt Ausbrüche bei Geflügel und Fälle bei Wildvögeln, insbesondere im Bereich der Schwarzmeerküste. In Westafrika verursachen sie hingegen seit dem Winter 2014/2015 bis in die Gegenwart kontinuierlich Geflügelpestausbrüche.
2010 entstanden viele neue Suptypen
Aufgrund der Reassortierung mit verschiedenen niedrig- und hochpathogenen Influenzaviren entstanden in China seit 2010 neue HPAIV H5-Subtypen innerhalb der Klade 2.3.4.4 mit neuen Neuraminidase-Subtypen (N2, N5, N6, N8), die sich rasch in Ostasien (China und Korea) sowohl bei Geflügel als auch unter Wildvögeln verbreiteten (Yoon et al., 2015; Kim et al., 2015).
HPAIV H5N8 erreichte im Winter 2014/2015 Europa (Verhagen et al., 2015; Conraths et al., 2015; Harder et al., 2015), aber auch Kanada und den Nordosten der USA (Bevins et al., 2016; Shriner et al. 2016). Erstmals gelangte damit Ende 2014 das asiatische HPAIV H5 auf den amerikanischen Kontinent und breitete sich rasant und mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen bei Geflügel in einer Vielzahl von US-Staaten und in Kanada aus, wobei auch diverse Nachweise in Wildvögeln geführt wurden (Torchetti et al., 2015; Ip et al., 2015). Gegen Ende des ersten Halbjahres 2015 kam dieses Seuchengeschehen zum Erliegen.
Seuchenzüge in Amerika und Europa
Die Viruslinie HPAI H5N8 der Klade 2.3.4.4 kommt in zwei genetisch unterschiedlichen Varianten vor: HPAIV H5N8 Linie 2.3.4.4 A und B. Die H5N8-Viren des Jahres 2014/2015 in Europa und Nordamerika gehörten der Linie A an, die H5N8-Viren des Jahres 2016/2017 in Russland, Indien und Europa der Linie B.
Im Winter 2016/2017 kam es in Europa zu massiven Ausbrüchen der Klassischen Geflügelpest. In Deutschland wurden mehr als 90 Geflügelbetriebe vom Erreger der Klassischen Geflügelpest (Subtyp H5N8) heimgesucht, eine Rekordzahl, die bis dato noch nie dokumentiert wurde. Auch in der Zukunft werden vermutlich Geflügelpestausbrüche auftreten.
Wie können wir uns schützen? Den Seuchenzug 2016/2016 in Europa und Deutschland und welche Maßnahmen die Geflügelhalter ergreifen sollen, um sich vor einem Eintrag des Virus in ihre Bestände zu schützen, beschreibt Dr. Anja Globig, FLI, im DGS-Magazin 35/2017.