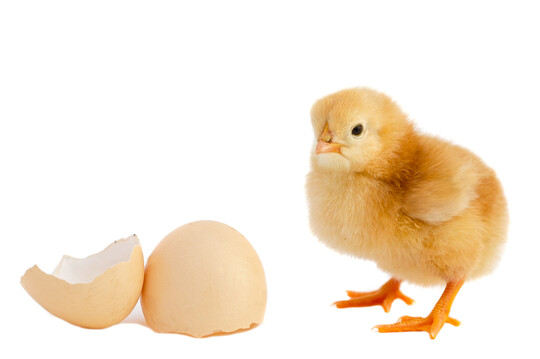Eiererzeugung
Alternativen zum Kükentöten: In-ovo-Sexing oder Bruderhahn?
Welche aktuellen Entwicklungen gibt es bei der Geschlechtsbestimmung im Brutei? Und wer macht das Rennen in der Ökobranche: der Bruderhahn oder die Früherkennung des Geschlechts im Brutei?
- Veröffentlicht am

Der Ausstieg aus dem Kükentöten wird EU-weit, vermutlich mit langen Übergangsfristen, kommen, prophezeit Prof. Dr. Rudolf Preisinger von der EW Group. Die Frage ist nur, wann. „Die EU forciert eine flächendeckende Lösung. Aber wie diese aussehen soll, bleibt noch offen“, sagte er auf einer Legehennen-Fachtagung des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen (LLH) im Februar dieses Jahres. Laut dem Unternehmen Agri Advanced Technologies (AAT), von dem die nicht invasive Cheggy-Technologie stammt, werden aktuell etwa 20 % der Legehennen in Europa in ovo gesext – Tendenz steigend. Umfragen in Ländern aus allen Teilen der Welt würden eine deutliche Präferenz von Konsumenten für Eier, die ohne das Töten männlicher Eintagsküken produziert werden,...