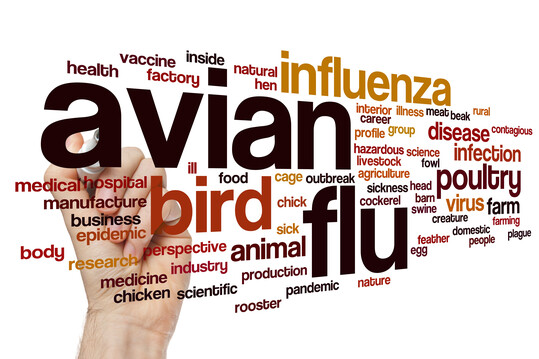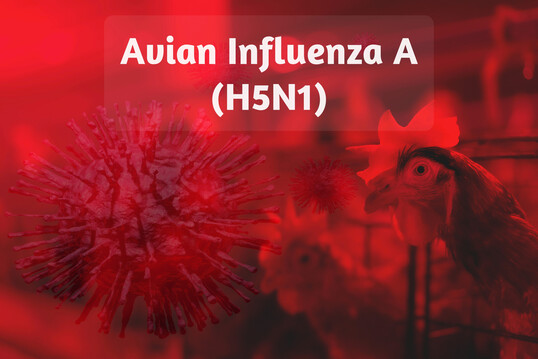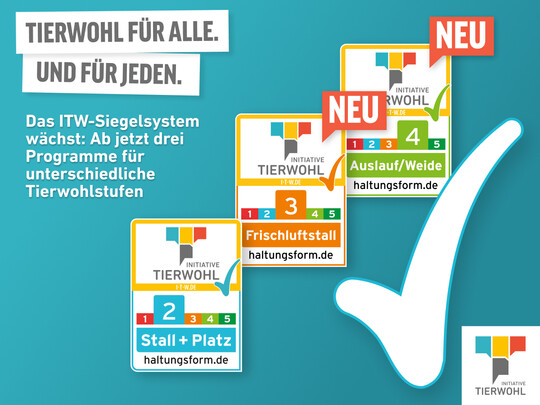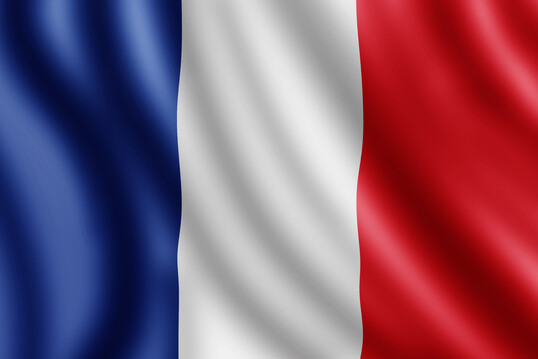
Geflügel sanft beproben
Impfung gegen HPAI wird möglich – doch das Monitoring bleibt die Herausforderung. Eine neue Methode mit Umweltproben versucht eine praxistaugliche, kostengünstige Lösung zu schaffen.
von Filip Lachmann Quelle Filip Lachmann erschienen am 25.08.2025Kalvelage: Korrekt. Das einzig Neue ist die Beprobung der Tränken mit den Handtupfern. Inspirieren ließ ich mich dazu unter anderem von der Arbeit von Dr. Erwin Sieverding, der sich mit dem Tränkewassermonitoring befasst hat.
Lachmann: Wie zuverlässig funktioniert das Monitoring?
Kalvelage: Indem man die Tränken mit den speziellen Handtupfern umfährt, bleibt wesentlich mehr genetisches Material haften als bei einer punktuellen Beprobung. Wir erhalten demzufolge eine sehr umfangreiche Untersuchungsgrundlage. Nachdem die Vorversuche vielversprechend waren, habe ich den aktuellen Versuch gestartet. Genau genommen ist es im wissenschaftlichen Sinne kein Versuch, sondern eine Anwendungsbeobachtung. Die Forschungsergebnisse sind vorläufig, da die Arbeit bislang nicht publiziert wurde. Ich strebe eine Veröffentlichung im Herbst an.
Lachmann: Was steht einem breiten Praxiseinsatz derzeit im Weg?
Kalvelage: Im Grunde erlaubt die EU-Verordnung im Rahmen der aktiven und passiven Monitoring-Richtlinien auch alternative Methoden einzusetzen. Eine der Voraussetzungen hierfür ist, dass diese mindestens die gleichen Leistungsmerkmale wie die Referenzverfahren aufweisen. Ferner muss das alternative Verfahren in mehreren Betrieben und Ställen angewendet worden sein, um eine statistische Aussagekraft zu gewährleisten. Die Krux bei solchen Projekten ist, dass einerseits ein großer Bedarf an Monitoring-Verfahren besteht, andererseits gestaltetet es sich schwierig, ausreichend Praxispartner für die Versuche zu finden.
Lachmann: Welche Hürden bestehen hier konkret?
Kalvelage: Eine der größten Herausforderungen bestand darin, jeden Betrieb im Einzelgespräch von meiner Idee zu überzeugen. Beiderseits muss Zeit in das Projekt investiert werden. Hilfreich ist, dass ich selbst Landwirt bin und auch dank meiner Familie gut in der Branche in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg vernetzt. Die Hilfsbereitschaft aller Beteiligten im Zuge des Projekts war sehr groß. Ich konnte 23 Betriebe mit 56 Ställen für das Projekt gewinnen und musste mehr als 5.500 individuelle Tupfer von lebenden Tieren nehmen – und das mehr oder weniger neben meiner regulären Arbeit in der Praxis. Mein Arbeitgeber war hier sehr entgegenkommend.
Lachmann: Wie aufwändig ist das Verfahren für Tierhalter und wie schonend für die Tiere?
Kalvelage: Mein Monitoring-Verfahren ist sehr leicht durchführbar. Idealerweise wenden es die Geflügelhalter alle zwei Wochen an, wobei sie pro Stall zwischen 5 und 10 Minuten einplanen sollten. Am besten erfolgt es im Anschluss an die tägliche Stallroutine. Die Tiere müssen dabei nicht angefasst werden. Im Gegensatz zum gesetzlich vorgeschriebenen Monitoring, bei dem einzelne Tupferproben gezogen werden müssen, senkt mein Ansatz den Arbeitsaufwand, die Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter und Tiere sowie die Betriebskosten. So muss der Tierarzt eben nicht mehr alle 30 Tage 60 Tracheal-Kloakal-Tupfer nehmen oder täglich die Falltiere beproben. Dafür benötigt der Tierarzt normalerweise noch eine zweite Person, was Kosten verursacht. Um eine sichere Beprobung der Luftröhre und der Kloake vornehmen zu können, müssen die Tiere aktuell angehoben werden, was einen Eingriff in die Tiergesundheit darstellt. Und bei einem Putengewicht von teils über 20 kg ist es auch eine Frage der Personalgesundheit.
Lachmann: Welche finanziellen Vorteile erhoffen Sie sich durch ihren Monitoring-Ansatz?
Kalvelage: Mit den vorläufigen Daten, schätze ich, dass Kosteneinsparungen von bis zu 80 % gegenüber den herkömmlichen Monitoring-Verfahren realistisch sein könnten. Der Tierarztbesuch verursacht die mit Abstand höchsten Kosten. Veranschlagt man pauschal 250 Euro Gesamtkosten pro Betriebsbesuch und rechnet für eine Mastperiode ohne Aufzucht mit vier Besuchen pro Durchgang, dann summiert sich das auf 1.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für PCR-Tests und Labor. Meine Methode könnte der Landwirt in Eigenregie anwenden, ohne tierärztliche Betreuung.
Lachmann: Welche Geflügelarten können mithilfe Ihres Monitorings überwacht werden?
Kalvelage: Im Rahmen der Arbeit habe ich keine unterschiedliche Tierarten oder Haltungssysteme getestet. Durch die Kombination aus Socken- und Handtupfern spielt das verwendete Tränkesystem keine entscheidende Rolle. Auch für Hobbygeflügelhalter könnte die Methode geeignet sein, da sie so auf Geflügelschauen die geforderten negativen AI-Nachweise eigenständig erbringen könnten. Außerdem können wir nicht nur auf Influenza Typ A, sondern auf die unterschiedlichsten Parameter untersuchen; virale Erkrankungen etwa oder auf Kokzidien.
Lachmann: Wie erfolgt die Auswertung der Proben?
Kalvelage: Das Monitoring kann von jedem Angestellten des Betriebs angewendet werden, da die beprobten Socken relativ unempfindlich sind. Es ähnelt der Salmonellenuntersuchung. Im Rahmen der Untersuchung führte ich Lagertests bei Raumtemperatur durch, um zu ermitteln, wie lange die AI-Erreger nachweisbar sind. Es zeigte sich, dass der Versand der Proben per Post kein Problem darstellt. Der Nachweis von aviärem beta-Actin zeigt an, ob die Proben tatsächlich im Stall genommen worden sind. Je nach Labor dauert es 12 bis 24 Stunden, dann liegen die Ergebnisse vor.
Lachmann: Welche Maßnahmen können aus den Monitoring-Ergebnissen abgeleitet werden?
Kalvelage: In einem AI-geimpften Gebiet werden infizierte Tiere ausfindig gemacht. Das ist einer der schnellsten und günstigsten Wege, sichere Ergebnisse zu erzielen. Fallen positive AI-Fälle auf, dann wird mittels Tracheal-Kloakal-Tupfer nachbeprobt. Das ist immer noch der Goldstandard. Dann entscheidet das Veterinäramt, ob – im Falle einer HPAI – ein Bestand eventuell gekeult werden muss.
Mein Monitoring-Verfahren ist sehr leicht durchführbar. Idealerweise wenden es die Geflügelhalter alle zwei Wochen an, wobei sie pro Stall zwischen 5 und 10 Minuten einplanen sollten. Leonard Kalvelage