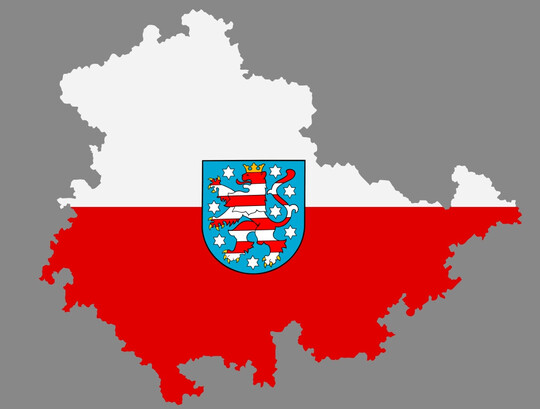Niedersächsische Geflügelwirtschaft: Zurück zu mehr unternehmerischer Freiheit
Am 21. Oktober 2024 hatte die Niedersächsische Geflügelwirtschaft – Landesverband e. V. (NGW) zur jährlichen Mitgliederversammlung nach Dötlingen eingeladen. Themen waren unter anderem Klimawandel, weltpolitische Unsicherheiten und Verbraucherwünsche.
von Yvonne Nemitz (DGS Redaktion) erschienen am 29.10.2024Mit einer Bruttowertschöpfung von 8,6 Mrd. Euro trägt die deutsche Geflügelwirtschaft einen wichtigen Anteil zur wirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands bei. Die Zahlen von 2022 weisen dabei eine Produktion von 1,5 Mio. t Geflügelfleisch und 15,5 Mrd. Eiern aus. Zudem waren bzw. sind 170.000 Menschen in der Branche beschäftigt. „Niedersachsen hat zu zwei Dritteln Anteile an diesen Zahlen. Das ist Würde und Bürde zugleich“, betonte Friedrich-Otto Ripke in seiner Ansprache an die Mitglieder des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes (NGW) am 21. Oktober 2024 in Dötlingen.
Branche weiß, Herausforderungen zu begegnen
„Geflügelhalter, Verarbeiter und Vermarkter, Tierärzte, Futtermittelhersteller, Stalleinrichter, Hochschulen, Zuchtunternehmen und Verbände bilden einen einmaligen Wertschöpfungs- und Kompetenz-Cluster“, führte Ripke aus. Was in anderen Wirtschaftsbereichen erst mühsam aufgebaut werden müsse, existiere in der niedersächsischen Geflügelwirtschaft bereits seit vielen Jahren. Die Branche sehe sich mit großen Herausforderungen konfrontiert, wüsste ihnen aber zu begegnen, sagte er weiter.
Was die Geflügelwirtschaft seitens der Politik aber brauche, seien unternehmerische Freiheit und faktenbasierte, folgenabgeschätzte Entscheidungen. „Denn Mehrung und Erhalt des Wohlstandes in Deutschland sind nicht möglich“, begründete Ripke, „wenn die politischen Verantwortlichen nicht intensiver mit der Wirtschaft zusammenarbeiten.“
Auf seiner Mitgliederversammlung beschäftigte sich der NGW mit drei großen Herausforderungen der Zeit: dem Klimawandel, den weltpolitischen Unsicherheiten und den aktuellen Verbraucherwünschen – wie etwa nach mehr Tierwohl. Das könne und wolle die heimische Geflügelwirtschaft erfüllen, unterstrich Ripke. Dass Geflügelfleisch und Eier aus hiesiger Produktion unter höchsten Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards produziert werden, haben die NGW-Mitglieder maßgeblich vorangetrieben.
Nachfrage nach Eiern und Geflügelfleisch hoch
Auch in noch mehr Tierwohl würde die Geflügelwirtschaft investieren, wenn dazu die politischen Rahmenbedingungen geschaffen würden, sagte er weiter. Das sollte aber nicht von Zuschüssen des Staates abhängig sein. Vielmehr sollten den Unternehmen wieder mehr Freiheiten gelassen werden, um auf das reale Kaufverhalten der Verbraucher am Markt besser und schneller eingehen bzw. es bedienen zu können. Die Nachfrage nach Geflügelfleisch und Eiern sei erfreulich hoch und steige kontinuierlich weiter. Zu hohe Lohn- und Energiekosten müssen seitens der Politik aber schnell korrigiert werden, mahnte der NGW-Vorsitzende. Die Regierung müsse Importen von Billiglebensmitteln konsequent einen Riegel vorschieben, wenn diese den hiesigen Produktionsstandards nicht entsprechen.
COPLANT-Studie gestartet
Auf der an die NGW-Mitgliederversammlung anschließenden Vortragstagung stellte Dr. Juliane Menzel vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Ergebnisse der „Risks an Benefits of Vegan Diet“ (RBVD)-Studie vor. Im Rahmen dieser Studie wurden Auswirkungen pflanzenbasierter Ernährung auf den menschlichen Organismus untersucht. Es hat sich gezeigt, dass trotz geringerer natürlicher Aufnahme von Vitamin B12 bei Veganern die Versorgung im Vergleich mit der Mischkostgruppe ähnlich gut war. Zurückzuführen sei das aber auf eine hohe Supplementierungsrate, erläuterte Dr. Juliane Menzel. Die Jodversorgung war insbesondere bei Veganern nicht optimal. Zudem wurde deutlich, dass die Knochendichte von einer veganen Ernährung negativ beeinflusst wird.
Um pflanzenbasierte Ernährungsformen weiterführend zu untersuchen, hat das BfR gemeinsam mit dem Max-Rubner-Institut und fünf Universitäten sowie dem Institut für pflanzenbasierte Ernährung die COhort on PLANT-based Diets (COPLANT)-Studie aufgesetzt, die am 9. April 2024 an den Start gegangen ist.
Im Anschluss daran griff Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Qualität und Sicherheit GmbH (QS) das Thema Klimaschutz auf. Eigentlich, so leitete er seinen Vortrag ein, stehe das QS-System für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit. Doch nun sei auch die CSRD-Berichtspflicht in den Fokus von QS gerückt. Diese Berichtspflicht, so erklärte Hinrichs anschließend, betreffe bisher nur große Unternehmen. Diese müssen in ihrem Jahresabschluss künftig nicht nur über wirtschaftliche Aspekte berichten, sondern auch über Nachhaltigkeitsaspekte.
QS entwickelt Berechnungstool zur CO2-Bilanzierung
„Und einer dieser Aspekte ist das Thema CO2-Emission“, führte Hinrichs weiter aus. Bisher gelte das nur für große Kapitalgesellschaften. Doch bei QS gehe man davon aus, dass diese Berichtspflicht in den kommenden Jahren immer weiter heruntergeschraubt und am Ende auch die Landwirtschaft berühren werde. „Die Erstellung einer CO2-Bilanz ist aber extrem herausfordernd“, betonte der studierte Agrarökonom. Deshalb arbeitet QS inzwischen daran, die Klimaleistung in der Nutztierhaltung sichtbar zu machen. Ziele sind eine einheitliche Berechnung der einzelbetrieblichen CO2-Emissionen, eine Grundlage zur Optimierung der einzelbetrieblichen CO2-Emissionen, die Bereitstellung der Werte zur Ermöglichung der Berichtspflichten für nachgelagerte Bereiche und die Auskunftsfähigkeit der Branche zu CO2-Emissionen in der Landwirtschaft.
Ein zentrales Problem dabei seien die vielen unterschiedlichen Methoden zur Berechnung der CO2-Bilanz, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, erklärte Dr. Alexander Hinrichs. Das sei der Punkt gewesen, an dem die Wirtschaftsbeteiligten (Schlachtunternehmen und Futtermittelhersteller) auf das QS-System zugekommen sind, mit der Bitte, eine brancheneinheitliche Lösung zu finden. Zentrale Aufgabenstellungen sind nun das Festlegen einer Methodik, die Definition der Abgrenzung bzw. die Einbeziehung weiterer Branchen, die Klärung des Datenmanagements und die Zeitplanung. Das alles geschehe, so Dr. Alexander Hinrichs, in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer (LWK) Nordrhein-Westfalen, der LWK Niedersachsen, der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, dem Thünen-Institut und dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL).