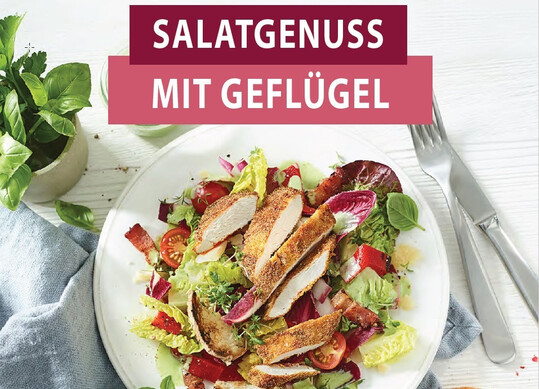Wer kauft wie ein?
Forscherinnen und Forscher der Universität Göttingen erheben seit Mitte April in einer deutschlandweiten Konsumentenbefragung, wie sich die Corona-Pandemie auf das Einkaufs-, Ernährungs- und Kochverhalten auswirkt und wie Bürger die Krisenfestigkeit des Ernährungssystems wahrnehmen.
- Veröffentlicht am

Die wesentlichen Ergebnisse der ersten Befragungswelle zeigen: Die Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen war zu Beginn der Pandemie hoch. Die Menschen kauften zudem seltener ein und legten bei der Auswahl der Produkte verstärkt Wert auf Haltbarkeit, allerdings auch auf Tier-, Klima- sowie Umweltschutz. Die Ergebnisse sind in einem Diskussionspapier am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Universität Göttingen erschienen.
Größte Sorge: Steigende Preise
Die Studie ist als Panelstudie mit insgesamt drei Erhebungswellen angelegt, dieselben Personen werden also drei Mal im Laufe der Pandemie online befragt. Dabei ist die Befragung in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung und regionale Verteilung repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland. An der ersten Runde nahmen 947 Personen teil. Ein Kernergebnis im Bereich der Risikowahrnehmung ist, dass die Ängste der Bürgerinnen und Bürger zum Befragungszeitpunkt im hohen Maß auf negative wirtschaftliche Folgen ausgerichtet sind. „Besonders auffällig ist, dass die Bevölkerung bereits Mitte April steigende Lebensmittelpreise befürchtet, ein Thema, das zu diesem Zeitpunkt in der öffentlichen Diskussion noch gar nicht so präsent war“, erklärt Dr. Gesa Busch, Erstautorin der Studie. Die Sorge vor steigenden Preisen ist größer als die Sorge vor Lebensmittelknappheit.
Einkaufsverhalten: Es wird seltener eingekauft
Beim Einkaufsverhalten zeigt sich: Es wird seltener eingekauft. Bevorzugte Produkteigenschaften sind nun verstärkt längere Haltbarkeit, Regionalität der Produkte und Gesundheit. Allerdings werden auch Tier-, Klima- und Umweltschutz für rund ein Viertel der Menschen wichtiger.
Ein Vergleich mit Daten aus einer Befragung mit Landwirten, die die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Marcus Mergenthaler der Fachhochschule Südwestfalen durchgeführt hat, zeigt, dass Landwirte diesen Punkt jedoch anders einschätzen: Sie nehmen an, dass diese Aspekte für Verbraucherinnen und Verbraucher während der Krise eher unwichtiger werden. Das Ernährungsverhalten ist hingegen bei einem Großteil der Befragten unverändert. Allerdings kochen nun mehr Personen als vor der Corona-Pandemie täglich ein warmes Gericht. Dies trifft verstärkt auf Personen zu, die aufgrund von Home-Office oder Quarantäne mehr Zeit zu Hause verbringen.
Hamsterkäufe: Ursache für Knappheiten
Interessanterweise verurteilen die Befragten sogenannte „Hamsterkäufe“ mehrheitlich stark und nur ein kleiner Teil gibt an, auf Vorrat eingekauft zu haben. In den Hamsterkäufen anderer Personen sehen die Befragten gleichzeitig auch den wichtigsten Grund für mögliche Lebensmittelknappheiten. Offizielle Marktdaten verzeichnen hingegen erhöhte Absätze in vielen Produktkategorien zu Beginn der Pandemie.
„Für diesen Widerspruch können unterschiedliche Punkte zum Tragen kommen“, so Busch. „Unter anderem kann es an einem Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung liegen: Es sind ,die anderen‘, die hamstern, aber nicht man selbst.“ Diese Einschätzung hat auch damit zu tun, dass angesichts geringer Lagervorräte in der Lebensmittelkette bereits subjektiv kleine Mehreinkäufe wie zwei Mehlpakete statt eines zu Regallücken führen, was wiederum den Eindruck von Knappheit verstärkt.
Knappheiten: Eher unwahrscheinlich für tierische Produkte
Lebensmittelknappheiten befürchten die Befragten in erster Linie bei Grundnahrungsmitteln, aber auch für saisonales Gemüse und exotisches Obst. Insbesondere für tierische Produkte und Backwaren sehen die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Verknappung als unwahrscheinlich an. „Die Ergebnisse bezüglich der Krisenfestigkeit des Ernährungssystems deuten auf eine beachtliche Unterstützung der Bevölkerung für einen hohen nationalen Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln hin“, so Prof. Dr. Achim Spiller.
Die Befragten stimmen relativ stark zu, dass die wesentlichen Grundnahrungsmittel oder eine Mindestmenge an Nahrungsmitteln in Deutschland oder noch besser regional produziert werden sollten. „Insgesamt lässt sich eine mehrheitlich globalisierungsskeptische Position in unseren Daten erkennen, die durch die Corona-Krise weiter gestärkt wird“, führt Spiller weiter aus. Ob mehr nationale Selbstversorgung aber wirklich sinnvoll für mehr Krisenfestigkeit ist, können die Autoren mangels einschlägiger Forschung derzeit noch nicht beantworten.