Legehennen gesund und leistungsfähig erhalten
- Veröffentlicht am

Bei den Impulsreferaten für die Podiumsdiskussion machte Dr. Thorsten Arnold den Anfang. Der Tierarzt für Tierhygiene und Mikrobiologie aus Ankum zeigte an einem Bild, dass das Huhn im Verhältnis zu seiner Körperlänge einen kurzen Darm hat.
Das Huhn hat einen empfindlichen Verdauungsapparat
Die verschiedenen Verdauungsabschnitte unterscheiden sich sehr in ihrer physiologischen Keimflora, erkärte Dr. Arnold. Diese ist sehr empfindlich und „kippt“ bei Störungen schnell um. Idealerweise sollen positive Keime den Darm besiedeln, bevor sich krankmachende Arten breitmachen können. Da Küken unter keimfreien bis keimarmen Bedingungen schlüpfen, muss man ihnen die positiven Keime „mitgeben“, empfahl er. Auf das Thema „Fettleber“ angesprochen wies Dr. Arnold darauf hin, dass dieses Problem vor allem in der Käfighaltung aufgetreten war, weil die Tiere dort wenig Bewegung hatten.
Das Thema Futterzusatzstoffe ist nicht neu
Gesundheit hängt nicht nur von den Hauptnährstoffen ab. Auch schon früher wurden den Futtermischungen Zusatzstoffe beigemischt, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern und erhalten sollten, demonstrierte Dr. Egbert Strobel, Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH in Neuenkirchen-Vörden, anhand eines Buches aus dem Jahr 1949. Als Beispiele nannte er Kohle, Tabakmehl – sollte gegen Wurmbefall helfen – oder Lebertran, der viele Vitamine enthält. Auch heute werden die Futtermischungen dem Bedarf gemäß ergänzt mit Aminosäuren, Spurenelementen, Vitaminen, Phytasen, Darmstabilisatoren oder Phytogenen.
Damit sollen Gesundheit und Wohlbefinden der Hennen erhalten werden, betonte der Tierernährungsspezialist. Bei den Spurenelementen spielen vor allem Mangan und Zink für die Festigkeit der Eischale, Zink auch für die Federbildung und das Knochenwachstum und Selen für Wachstum und Legeleistung eine wichtige Rolle. Vitamine werden zum Teil standardmäßig zugesetzt, weil die natürlichen Gehalte in den Futtermitteln nicht ausreichen. Der Zusatz der Aminosäuren Methionin, Lysin und Threonin hängt ab vom Rohproteingehalt der Futtermischung. Zur Stabilisierung der Darmflora können Probiotika oder organische Säuren eingesetzt werden. Auch die Wirkungen von Kräutern oder ätherischen Ölen können genutzt werden.
Was kann man tun, um Gefährdungen abzuwenden? Bei Junghennen können Kokzidiostatika gegeben werden. Um Mykotoxine zu binden, kann dem Futter eine Mischung aus Tonmineralen, Hefen und Enzymen zugesetzt werden, Antioxidantien fördern die Futteraufnahme und senken Stress und Krankheitsrisiko, empfiehlt Dr. Strobel.
Ökolandwirt Brede setzt auf eigene Mischungen
Die erfolgreiche Legehennenhaltung fängt mit der Aufzucht der Junghennen an, ist Uwe Brede überzeugt. Der Öko-Landwirt aus Knüllwald, Hessen, zieht seit einiger Zeit seine Junghennen selber auf und hat festgestellt, dass seine Legehennenhaltung seitdem viel erfolgreicher ist. Brede bewirtschaftet 180 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche mit einer vielseitigen Fruchtfolge und hält 10500 Legehennen und zieht pro Jahr 19800 Junghennen auf. Die Aufzucht beginnt er mit einem Kükenstarter, dann Junghennenfutter, Vorlegemehl und zwei Legemehlmischungen. Seine Mischungen enthalten immer dieselben Komponenten. Das Vorlegemehl enthält Kalk. Ackerbohnen werden bis zu einer Menge von 15 % eingesetzt, wegen der Bitterstoffe werden sie geschält. Seine Ställe sind sehr hell, im Sommer sind die Tiere draußen.
Der Erfolg gibt Uwe Brede recht: Die Hennen sind gesund, die Legeleistung ist stabil, die Eiqualität gut. Federn auf der Einstreu zeigen, dass den Tieren weder Nährstoffe noch Beschäftigungsmöglichkeiten fehlen. Die 100%ige Biofütterung wird positiv vermarktet und vom Verbraucher honoriert, zählt Brede die Vorteile seines Systems auf. Aber der Aufwand ist auch hoch: Er braucht viel Lagerkapazität für die verschiedenen Komponenten, Lagermanagement und Dokumentationsaufwand sind hoch, ebenso der Aufwand für das Mahlen und Mischen.
Hennenhalter Strauß gibt seinen Hennen feste Futterzeiten
Thomas Strauß, Landwirt aus Geiselhöring/ Bayern, gehört zu den Demonstrationsbetrieben für Tierschutz. Er bewirtschaftet 40 ha Acker und hat 13352 Legehennenplätze. Der aktuelle Bestand beläuft sich auf 10000 Tiere in vier Ställen, 98 % werden direkt vermarktet. 2012 machte er die ersten Erfahrungen mit Hennen mit intaktem Schnabel, die waren jedoch nicht so gut. Seit 2015 nimmt er am Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutzprojek teil, und seitdem sind auch seine Erfahrungen mit Hennen mit intaktem Schnabel positiv. Er führt das zurück auf die zusätzlichen Maßnahmen, aber auch die fachliche Betreuung und die Fortbildung von Betriebsleiter und Mitarbeitern. Seit Fazit aus den vergangenen Jahren: Es gibt keine Patentrezepte.
Er gibt seine Erfahrungen weiter: Grundsätzlich: jeder Stall muss mindestens ein eigenes Silo haben, dann kann das Futter an den Bedarf angepasst werden und Nassreinigung ist gut möglich. Säurestabile Magensteinchen sind wichtig, außerdem Bierhefe für die Darmflora. Vorlegefutter mit 2 % Magermilchpulver und extra Methionin sowie mit 3 % Kalk hat sich bewährt. Thomas Strauß setzt auf feste Futterzeiten: je einen Block vor und nach dem Legen, drei bis vier Fütterungen am Nachmittag, die letzte mindestens eineinhalb Stunden vor dem Dunkelwerden. Wird zu viel Futter verschwendet, sollte man die Troghöhe erhöhen. Der Schnabelabrieb sollte am besten an der Futterkette geschehen.
Futter spielt neben Aufzucht und Management eine wesentliche Rolle. Hier legt der Aufzüchter schon den Grundstein, daher sind Absprachen mit ihm notwendig. Wie sollte das Futter beschaffen sein? „Wir füttern einen Allesfresser vegan“, stellte Strauß fest, das Problem sei jedoch die Zulassung und Verfügbarkeit und Preis von tierischem Protein. Da gäbe es noch keine Lösung. Gelöst hat er die Frage des Energiegehaltes in der Ration. Strauß hat gute Erfahrungen gemacht mit einer Energie-reduzierten Mischung mit 10 % Gerste bzw. Hafer. Durch den Hafer, der nicht fein vermahlen sein darf, werden die negativen Bakterien im Darm reduziert, die Verdauung wird verlangsamt und der Kot ist trockener. Eine homogene grobe Struktur des Futters ist am besten für die Verdauung des Huhns.
Rege Diskussion mit den Zuhörern
Eiweiß im Futter und Einstreupflege wurden von den Teilnehmern der Tagung diskutiert. Küken fressen in der Natur in den ersten Lebenswochen etwa 80 % tierisches Protein. Das könnte in der Kükenaufzucht auch realisiert werden, so die Forderung aus dem Zuhörerraum, zum Beispiel mit Insektenprotein, denn Küken haben in den ersten Lebenswochen einen hohen Proteinbedarf. Der muss sonst durch aufwendige Mischungen erreicht werden.
Einstreu muss kurz gehalten werden und auf jeden Fall trocken, sonst gibt es Brutstellen für Clostridien. Eventuell kann der Parasitendruck höher sein. Dr. Arnold empfiehlt, ggf. Milben zu bekämpfen. Durch Einbringen von Körnern können Hennen dazu angeregt werden, die Einstreu gut durchzuarbeiten. Dr. Keppler weist jedoch darauf hin, dass die Mist-Einstreu-Mischung nicht über die gesamte Legeperiode im Stall verbleiben dürfe, die Lagerzeit von 15 Monaten oder zum Teil noch mehr sei zu lang.
Salzmangel tritt bei Legehennen immer wieder mal auf. Salz lässt sich jedoch schwer homogen ins Futter mischen. Laut Dr. Christiane Keppler, Geflügelberatung am Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, haben die Hennen manchmal nur zwei Möglichkeiten, an Salz zu kommen: über Blut oder über den Kot. Letzterer würde schon beim Abkoten aufgepickt, dann käme es auch sehr schnell zum Kloakenkannibalismus. Picken von blutigen Federfollikeln sei ein Zeichen von Nährstoffmangel, würden Federn gefressen, sei es vom Boden oder zum Beispiel auch vom Brutfleck, deute das auf Rohfasermangel.
Fazit: Alles muss zusammenpassen
Es müssten im Stall immer Haltung, Fütterung und Management miteinander betrachtet werden, alles spiele zusammen. Die wichtigsten Punkte fasste Dr. Keppler am Schluss zusammen:
- Nährstoffversorgung sichern und einen Puffer einbringen
- Unbedingt für Struktur sorgen
- Viel Futter sorgt für Nährstoffe und Beschäftigung
- Der Tierhalter muss das Futter regelmäßig kontrollieren und beurteilen
- Säure
- Futterzusatzstoffe
Einen ausführlichen Bericht über das 1. Geflügelkolloquium lesen Sie in DGS-intern 47/2017.





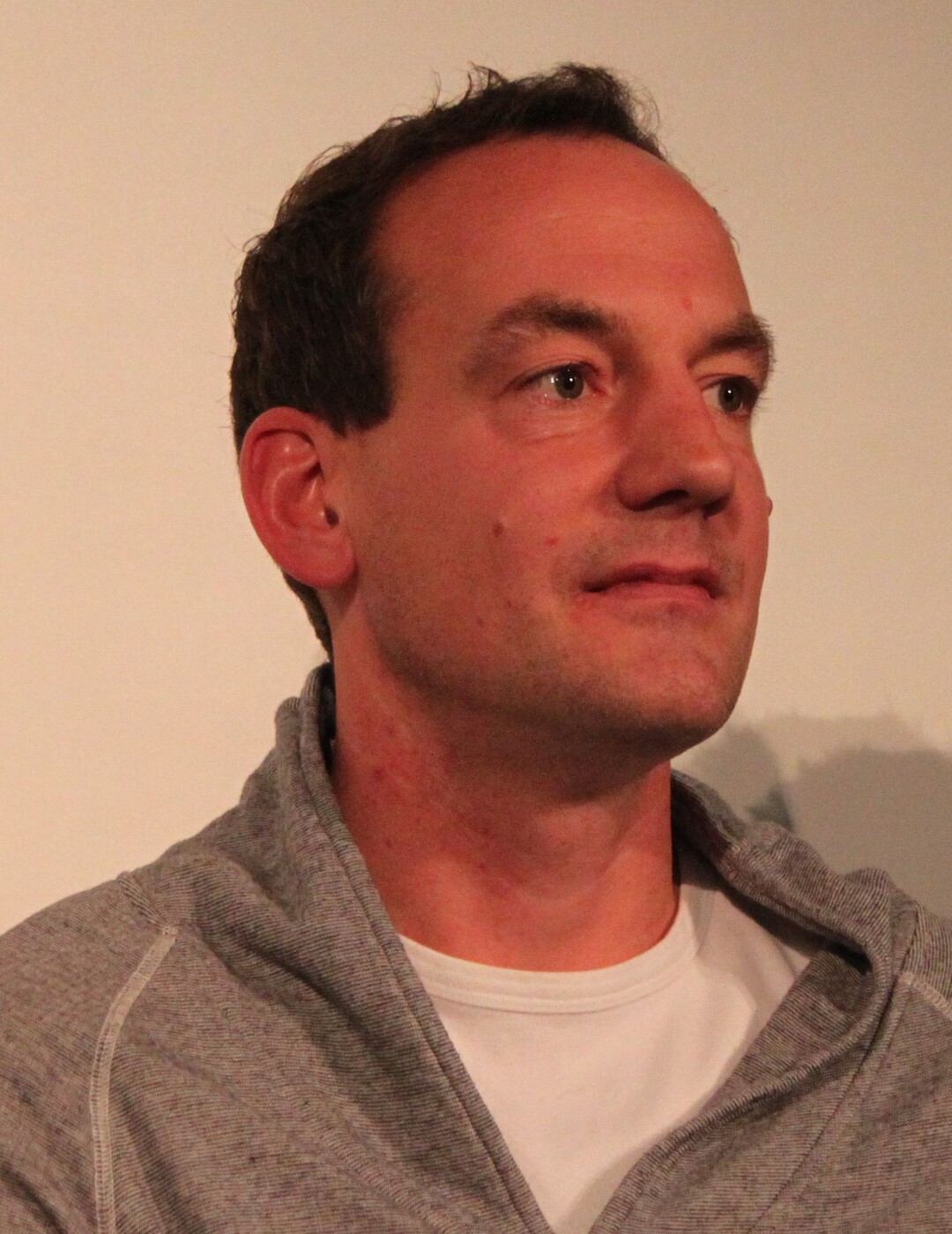

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.