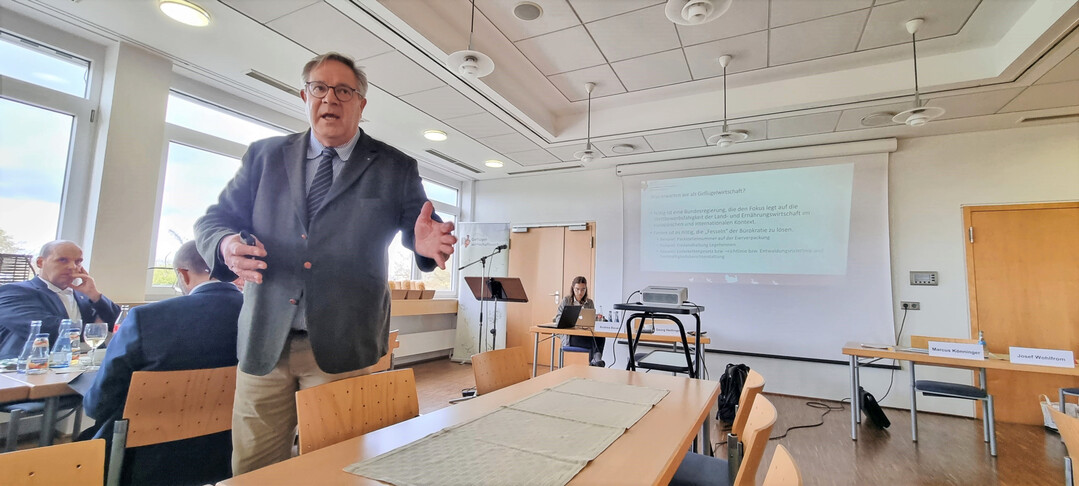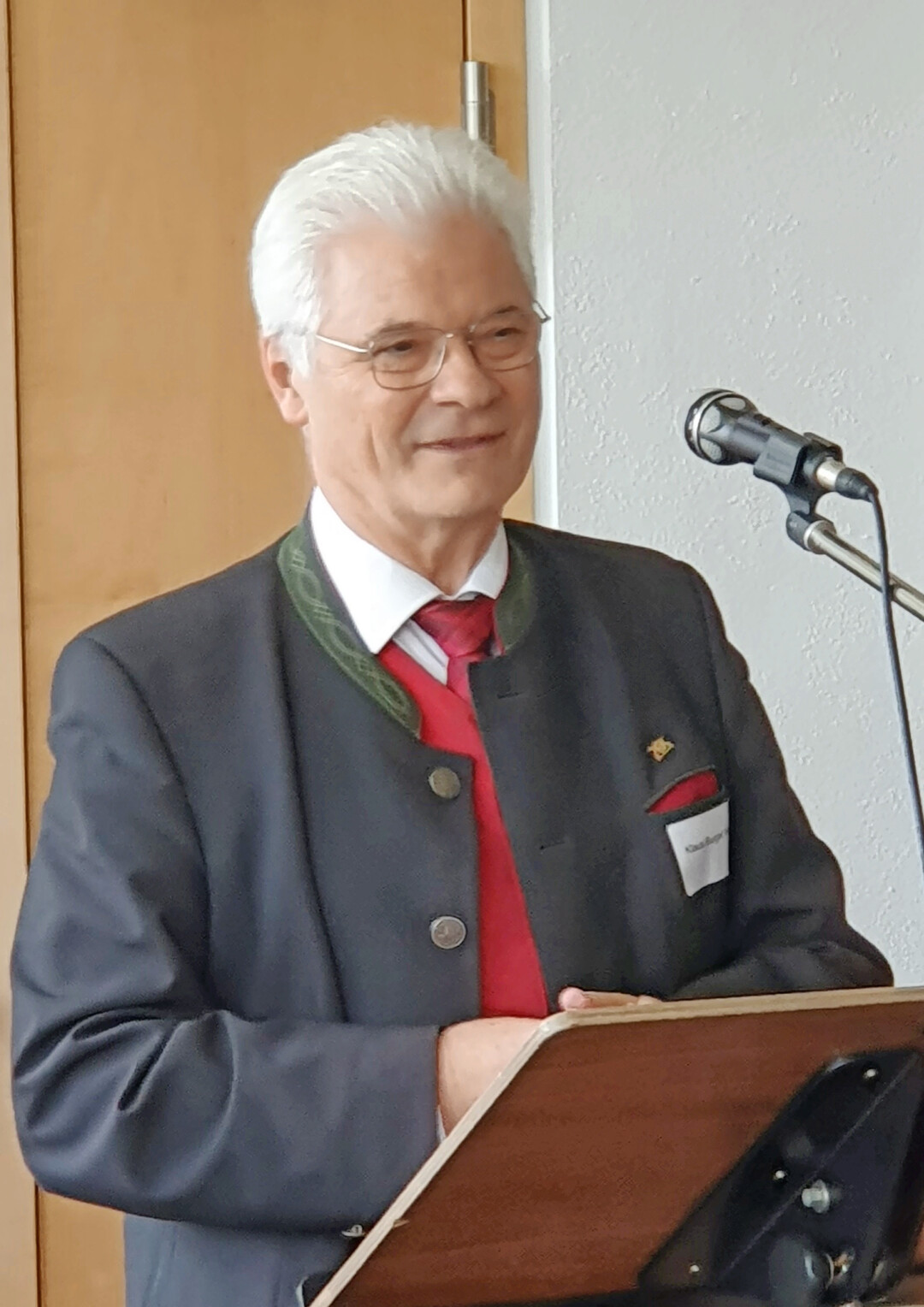„Wir können nicht warten, bis die erste Ente tot vom Himmel fällt!“
Am 28. Oktober 2025 fand die Mitgliederversammlung des Geflügelwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg e.V. in Denkendorf statt. Auf der Tagesordnung standen Fachvorträge, Berichte aus den Fachbereichen und aktuelle Branchenthemen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden diskutierten die Herausforderungen der Geflügelwirtschaft im Spannungsfeld von Tierseuchen, Marktbedingungen und Genehmigungsverfahren.
von Vivien Kring erschienen am 31.10.2025Zur Mitgliederversammlung des Geflügelwirtschaftsverbandes (GWV) Baden-Württemberg am 28. Oktober in Denkendorf sprach der Vorsitzende Georg Heitlinger die anhaltende Verunsicherung der Branche durch die Geflügelpest an. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung unter erweiterten Biosicherheitsmaßnahmen mit einer Desinfektionsschleuse statt, um das Risiko einer Ansteckung zu verringern. Heitlinger bezeichnete die Geflügelpest als „Damoklesschwert“, das über der Branche hänge, und kritisierte die häufige Gleichsetzung mit Massentierhaltung. Viele Außenstehende würden ohne Fachkenntnis urteilen, während die Betriebe im Alltag Verantwortung übernähmen.
Stark beschäftigt habe die Branche die Schließung des Schlachthofs Buckl in Wassertrüdingen Ende April. Auch bei der Umsetzung der „TA Luft“ gebe es bislang kaum Fortschritte seitens der Politik.
Geplant waren zwei Fachvorträge – von Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), und Falk Kullen, Geschäftsführer der MBW Marketinggesellschaft mbH.
Vogelgrippe: Goldnick fordert entschlossenes Handeln ein
Klaus Burger von der CDU, Mitglied des Landtags Baden-Württemberg und Vorsitzender des Arbeitskreises Ländlicher Raum, dankte den Geflügelhaltern für ihren Beitrag zur regionalen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln und zur nachhaltigen Ernährung. Burger betonte den Spagat zwischen gesetzlichen Vorgaben und Verbraucherwünschen und ging auf den Kampf gegen die Vogelgrippe ein. Landwirtschaftsminister Peter Hauk lasse ausrichten, dass die Monitoringmaßnahmen in Bezug auf die Wildvogelbeprobung und Überwachung der Rastplätze intensiviert würden. Eine Aufstallpflicht könne rechtlich erst angeordnet werden, wenn entsprechende Nachweise bei Wildvögeln vorlägen.
ZDG-Präsident Hans-Peter Goldnick widersprach seinem Vorredner. Er stellte klar, dass die Geflügelwirtschaft entschlossen handeln müsse, um Seuchenausbrüche zu verhindern: „Wir können nicht warten, bis die erste Ente oder der erste Kranich tot vom Himmel gefallen ist“, so Goldnick. Das Risiko eines Viruseintrags sei angesichts des hohen Anteils von Freiland- und Biohaltung – über 30 % der Legehennen – zu groß. Diese Tiere seien besonders gefährdet, da sie täglich im Außenbereich gehalten würden.
Er beschrieb die aktuelle Lage als Spannungsfeld zwischen politischer Realität, öffentlicher Wahrnehmung und den praktischen Anforderungen der Landwirtschaft. Viele politische Entscheidungen würden ohne ausreichenden fachlichen Hintergrund getroffen: „Oft erleben wir plakative Reden, aber wenig Sachverstand.“ Seine Forderung lautete, wissenschaftliche Grundlagen und Praxiserfahrungen wieder zum Ausgangspunkt politischer Entscheidungen zu machen – auf allen Ebenen von der EU bis zu den Landkreisen.
Quo vadis deutsche Geflügelwirtschaft?
Der ZDG-Präsident erläuterte die Grundsätze und Zielrichtungen des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft:
- Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Geflügelwirtschaft erhalten und stärken,
- europäische Rechtsrahmen harmonisieren,
- die nachhaltige Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung von Tier-, Verbraucher- und Umweltschutz fördern,
- Qualität und Produktsicherheit gewährleisten,
- sowie Forschung, Innovation und den Austausch innerhalb der Branche intensivieren.
Mit Blick auf den Markt zog Goldnick eine differenzierte Bilanz: Die Nachfrage nach Geflügelfleisch sei in den letzten 25 Jahren um 25 Prozent gestiegen, das entspreche einem jährlichen Wachstum von rund einem Prozent. Um die heimische Nachfrage zu decken, müsse Deutschland künftig mehr produzieren – was angesichts geplanter höherer Haltungsstufen jedoch schwieriger werde, da diese mit geringeren Tierzahlen einhergingen. Auch beim Ei zeige sich eine positive Entwicklung: Der Pro-Kopf-Verbrauch sei innerhalb eines Jahres um rund zwölf Eier gestiegen. Das Frühstücksei komme zunehmend aus deutscher Produktion, das Produkt habe sein Image grundlegend verändert – „vom Cholesterinrisiko zum wertvollen Proteinlieferanten“.
Ein strukturelles Problem stelle der Rückzug niederländischer Produzenten aus der intensiven Tierhaltung dar. Dadurch entfielen rund 20 % der bisherigen Importe nach Deutschland, was etwa 2,5 Millionen Legehennenplätze betreffe. Diese Kapazitäten müssten nun im Inland kompensiert werden. „Wir haben die guten Produkte und die guten Haltungsbedingungen“, so Goldnick, „aber wir müssen die Rahmenbedingungen erhalten, um sie auch weiter anbieten zu können.“
Er forderte eine Neuausrichtung der politischen Schwerpunkte. Nachhaltigkeit bleibe wichtig, müsse aber im Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gedacht werden. Die Bundesregierung solle die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft stärker in den Fokus rücken. Als konkrete Punkte nannte er:
- Eine Überarbeitung der Bau- und Immissionsschutzverordnung, um Stallneubauten zu ermöglichen,
- ein Moratorium der TA Luft, deren Vorgaben in der Praxis kaum umsetzbar seien,
- die Abschaffung der staatlichen Haltungskennzeichnung zugunsten der etablierten freiwilligen Kennzeichnung der Wirtschaft („haltungsform.de“),
- eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung im Außer-Haus-Verzehr,
- und die Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen im internationalen Handel („Level Playing Field“).
Goldnick warnte vor nationalen Alleingängen und sprach sich für die konsequente Umsetzung europäischer Regelungen aus. „Wer in die EU importiert, muss unsere Standards erfüllen“, so seine Forderung. Abschließend stellte er klar, dass die Geflügelwirtschaft nicht Teil des Trends zur fleischlosen Ernährung werden könne: „Bei veganem Eierlikör ist bei mir die Grenze überschritten.“
Sein Vortrag wurde mit großem Interesse aufgenommen. Klaus Burger bekräftigte anschließend, dass die Politik die Anliegen der Landwirte ernst nehme und hinter der Branche stehe.
Regionale Qualitätsvermarktung und Chancen für Erzeuger
Im zweiten Fachvortrag sprach Falk Kullen, Geschäftsführer der MBW Marketinggesellschaft mbH, über die Rolle der MBW im regionalen Qualitätsmarketing und die Möglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe, von den Landesprogrammen zu profitieren. Kullen erläuterte, dass die MBW als zentrale Schnittstelle zwischen Erzeugern, Handel, Gastronomie und Verbrauchern fungiere. Ihr Ziel sei es, Produkte aus Baden-Württemberg unter gemeinsamen Qualitätszeichen sichtbar zu machen und regionale Wertschöpfung zu sichern.
Zu den Aufgabenbereichen der MBW zählen Verkaufsförderung, Gemeinschaftsauftritte auf Messen und Veranstaltungen, Qualitätsprogramme, Öffentlichkeitsarbeit sowie Kooperationen mit der Gastronomie. Kullen stellte insbesondere die Marke „Schmeck den Süden – Baden-Württemberg“ vor, die landesweit als Symbol für Herkunft, Qualität und geprüfte Sicherheit steht. Die MBW vergibt dafür über Lizenznehmer Verträge an Erzeuger, Verarbeiter und Zeichennutzer, die bestimmte Qualitätsstandards und Herkunftsnachweise erfüllen müssen. Diese Standards werden auf allen Stufen regelmäßig kontrolliert.
Kritische Anmerkungen aus der Hähnchenmast
Josef Wohlfrom, Vorstandsmitglied im GWV und Hähnchenmäster, verdeutlichte, dass die Hähnchenmast in Baden-Württemberg derzeit nur eingeschränkt konkurrenzfähig sei. Der Hauptgrund liege im Mangel an geeigneten Schlachtkapazitäten. „Masthähnchen sind nicht im Programm von „Schmeck den Süden“, weil es in Baden-Württemberg keine geeignete Schlachterei mehr gibt“, erklärte er. Der Anteil der im Land erzeugten Hähnchen betrage nur rund 25 % des regionalen Verbrauchs – und diese Zahl werde voraussichtlich auf etwa 17 % sinken.
Er beschrieb eine deutliche Diskrepanz zwischen politischen und gesellschaftlichen Erwartungen auf der einen und den realen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft auf der anderen Seite. Während Handel und Verbraucher höhere Haltungsstufen forderten, scheiterten Stallneubauten und Erweiterungen in der Praxis häufig an Genehmigungsprozessen. „Im letzten Jahr wurde in ganz Baden-Württemberg nur ein einziger Stallbau genehmigt“, so Wohlfrom.
Wohlfrom sprach offen von einer wachsenden Frustration unter Landwirten. „Man möchte Haltungsstufe 3 oder 4, bei denen weniger Tiere pro Stall erlaubt sind – aber gleichzeitig werden keine neuen Ställe genehmigt. So helfen auch alle Marketingmaßnahmen nichts.“ Wohlfrom kritisierte zudem das Verhalten einiger Landratsämter, die Fristen setzten, Verfahren verzögerten oder rechtliche Vorgaben uneinheitlich auslegten. Dies führe dazu, dass viele Betriebe ihre Kapazitäten nicht an neue Marktanforderungen anpassen könnten. „Keiner zieht am gleichen Strang“, fasste er zusammen.
Trotz dieser strukturellen Schwierigkeiten zeichnete Wohlfrom ein grundsätzlich positives Bild der tierischen Leistung und Produktqualität in der Hähnchenmast. Die Kükenqualität sei hoch, das Zuwachspotenzial der Tiere hervorragend. „In nur 40 Tagen erreichen die Tiere über drei Kilogramm Gewicht – und das bei einem CO2-Fußabdruck, der im Vergleich zu anderen Fleischarten kaum zu übertreffen ist.“ Damit verwies er auf die hohe Effizienz und Klimabilanz der Hähnchenproduktion, die in der öffentlichen Diskussion seiner Ansicht nach zu wenig Beachtung finde.
Aus der Putenbranche: Strukturwandel und aktuelle Marktlage
Marcus Könninger, Vorstandsmitglied im Geflügelwirtschaftsverband und Vertreter der Putenbranche, berichtete über die aktuelle Situation der Putenhaltung in Deutschland. Nach der Übernahme des Putenschlachthofs DABE in Cloppenburg durch Heidemark sei geplant, diesen künftig als Hähnchenschlachthof zu nutzen. Damit verblieben bundesweit nur noch drei größere Puten-Schlachthöfe – zwei in Niedersachsen und einer in Bayern.
Die Marktlage sei grundsätzlich positiv, die Nachfrage nach Putenfleisch bleibe hoch. Gleichzeitig gehe die Produktion leicht zurück, unter anderem wegen der Umstellung auf Haltungsform 3, seuchenbedingter Einschränkungen in Polen und Importverboten aus Brasilien. Der Bedarf könne daher nicht immer vollständig gedeckt werden.
Könninger verwies zudem auf eine zunehmende Konzentration im Brütereisektor: Die Süddeutsche Truthahn AG sei Mehrheitsgesellschafterin der Putenbrüterei Böcker, wodurch nur noch wenige unabhängige Anbieter verblieben. Trotz dieser strukturellen Veränderungen bleibe der freie Kükeneinkauf möglich.
Wirtschaftlich sei die Lage derzeit auskömmlich, da die Futtermittelpreise 2025 leicht gesunken seien. Kritisch sah Könninger hingegen die Genehmigungspraxis bei Stallbauten und Tierwohlanbauten. Diese würden häufig verzögert oder gar nicht bewilligt, obwohl Handel und Verbraucher höhere Standards forderten. Zudem forderte er eine Differenzierung der Tierseuchenkassenbeiträge nach dem Vorbild anderer Bundesländer.
Könninger betonte, dass die Putenhalter bereit seien, den eingeschlagenen Weg zu mehr Tierwohl weiterzugehen, dazu aber verlässliche rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen benötigten.
Der erste Vorsitzende Heitlinger beendete die Mitgliederversammlung planmäßig gegen 17 Uhr mit den Worten: „Die Geflügelwirtschaft ist sexy!“
1 2