NGW steht hinter Borchert-Plan
„Wir halten die Empfehlungen der Borchert-Kommission zum Umbau der Tierhaltung für den zur Zeit wichtigsten Beitrag zur Planungs- und Zukunftssicherung der deutschen Nutztierhaltung“, das betonte Friedrich-Otto Ripke, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersächsische Geflügelwirtschaft (NGW).
- Veröffentlicht am
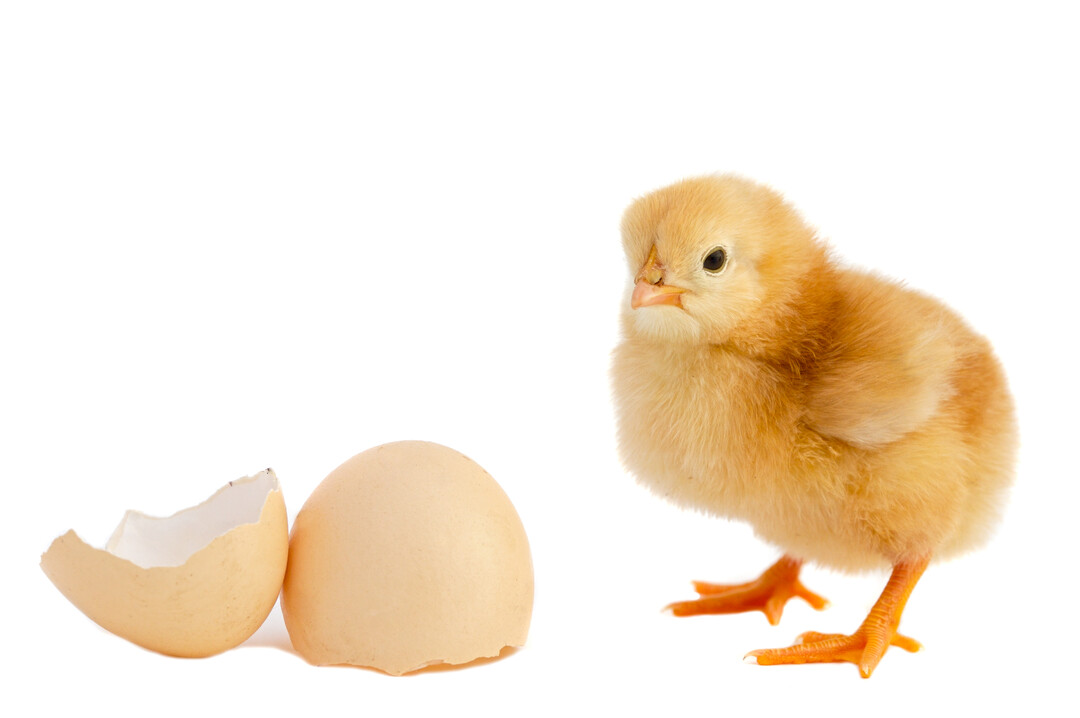
Bei der Mitgliederversammlung des NGW am 9. September in Dötlingen wurde u.a. dieses Thema diskutiert. Bei der nationalen Nutztierstrategie müssten Tierwohl und Zukunftssicherung für die heimische Landwirtschaft unter einen Hut gebracht werden. Dafür müsse zuerst das Bau- und Emissionsrecht geändert werden. Der aktuelle Referentenentwurf zur Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) sei mit einer Öffnungsklausel für Tierwohlverbesserungen zu ergänzen. Dafür müssten aber Bundesumweltministerium und Umweltverbände in der Verbandsbeteiligung mitspielen.
Erfreulich sei, dass die große Koalition im Bundestag zu den Borchert-Empfehlungen einen Entschließungsantrag eingebracht habe, der die Bundesregierung auffordere, bis zum Ende dieser Legislaturperiode auch einen Vorschlag zur Finanzierung der Tierhaltungskriterien vorzulegen. Das sei eine langjährige Forderung des NGW.
Langfristig sichere Finanzierung entscheidend
Mit Blick auf die Borchert-Vorschläge und den Verordnungsentwurf von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zur staatlichen Tierwohlkennzeichnung ist laut Ripke die langfristig sichere Finanzierung und Planbarkeit entscheidend. Aus Sicht der Geflügelwirtschaft sei dafür eine zweckgebundene Tierwohlprämie mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren über eine maßvolle Tierwohlabgabe seitens der Verbraucher nötig.
Für eine Breitenwirkung des staatlichen Tierwohllabels ohne lange Übergangsfristen müssten zudem die Kriterien der Initiative Tierwohl (ITW) Geflügel – insbesondere die Besatzdichte – in der Einstiegsstufe gelten. „Die erste Stufe muss praktikabel und bezahlbar sein, damit sie beim Verbraucher Akzeptanz findet“, betonte Ripke. Als notwendig sieht die Geflügelwirtschaft auch die Einbeziehung des Großverbrauchersegmentes in das Tierwohlkennzeichen an.
Wettbewerbsfähigkeit erhalten
Für unabdingbar hält Ripke den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Geflügelwirtschaft. Deswegen sei die Initiative der Bundesregierung für ein EU-weit verpflichtendes Tierwohlkennzeichen wichtig; bei der Ausgestaltung der nationalen Kennzeichnung müsse genau auf Konformität mit den EU-Vermarktungsnormen geachtet werden. Vor Einführung eines Tierwohllabels sei eine umfassende Folgenabschätzung unumgänglich.
Ripke wies darauf hin, dass die Selbstversorgungsgrade bei Eiern und Putenfleisch jeweils nur bei rund 70 % lägen, bei Hähnchenfleisch mit sinkender Tendenz bei 98 %. Das liege auch an der Vielzahl der nationalen Auflagen und Gesetze, die über das Niveau der internationalen Wettbewerber hinausgingen. Beispiele seien der Ausstieg aus dem Kükentöten ohne ausreichende Übergangsfrist oder das geplante Verbot von Werkverträgen bzw. der Arbeitnehmerüberlassung.
„Wenn die deutsche Politik nicht für europäische und bei den internationalen Handelsabkommen für globale Standards eintritt, geht unsere Wettbewerbsfähigkeit immer mehr den Bach runter“, warnte Ripke.


