Töten von Küken könnte bald ein Ende haben
Zwei Techniken zur Geschlechtsbestimmung im Ei, die schon bald die Praxisreife erreichen könnten, wurden kürzlich vorgestellt.
- Veröffentlicht am
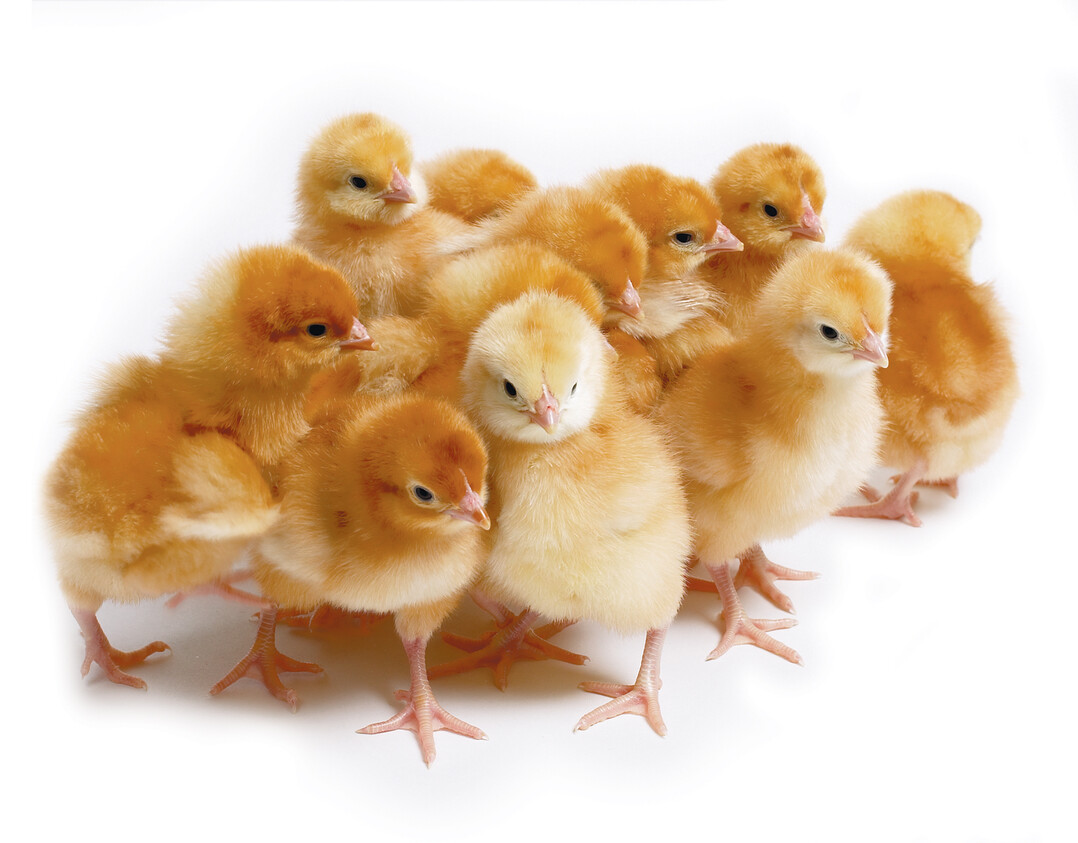
Gemeinsam mit Partnern aus den Bereichen Software-Entwicklung und Anlagenbau entwickelt die Firma Agri Advanced Technologies (AAT) – ein Schwesterunternehmen der Lohmann Tierzucht GmbH (LTZ) – eine neue Anwendung zur spektroskopischen Geschlechtsbestimmung im Ei. Die Anwendung baut auf die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderte Grundlagenforschung zur Spektroskopie auf und wird derzeit zu einer praxisgerechten Lösung für den Einsatz in Brütereien weiterentwickelt. Bei der Geschlechtsbestimmung mittels Absorptionsspektroskopie wird mithilfe eines optischen Verfahrens das Geschlecht von Hühner-Embryonen bereits im Ei identifiziert.
Mit der Anwendung möchte AAT die Problematik des millionenfachen Tötens männlicher Eintagsküken möglichst schnell beenden. „Wir sehen hierin eine große gesellschaftliche Herausforderung, auf die auch die Wirtschaft Antworten geben muss“, erklärt Jörg Hurlin, Geschäftsführer bei AAT. Dank umfassender Versuchsreihen an tausenden von Bruteiern in Brütereien der LTZ steht die Lösung möglicherweise kurz vor der Praxisreife.
Vollautomatisch und lernfähig
Die Visbeker Anwendung ist auf die Abläufe in Brütereien abgestimmt. So übernimmt die vollautomatisierte Lösung alle Schritte der Geschlechtsbestimmung – von der Entnahme der Eier aus dem Brutschrank, der Perforierung der Eischale und Abnahme des Eideckels, über die eigentliche spektroskopische Untersuchung sowie deren Auswertung und anschließende Trennung der Eier nach Geschlecht, bis hin zum Wiederverschluss des Eies und der Rückführung in den Brutschrank.
Zudem kann bereits am vierten Tag das Geschlecht zuverlässig bestimmt werden. Die Messung erfolgt darüber hinaus am stumpfen Pol des Eies, wodurch die Eihaut beim Eingriff intakt bleibt und die Schlupfrate der Küken nur sehr geringfügig beeinflusst wird. Für die Arbeitsabläufe in Brütereien ergibt sich hieraus ein Vorteil: Das Ei muss zur Geschlechtsbestimmung nicht umgedreht werden, wenn es aus dem Brutschrank entnommen wird, weiß Hurlin. „Genau diese Details sind es, auf die es beim Praxiseinsatz in einer Brüterei ankommt, in der täglich bis zu 100.000 Eier sortiert werden müssen.“
Seit 2012 wird gemeinsam mit Industriepartnern an der Entwicklung einer brütereitauglichen Anwendung gearbeitet. Das Besondere: Für die Ergebnisauswertung der spektroskopischen Messungen nutzt das System ein dem menschlichen Gehirn nachempfundenes Netzwerk, das sich selbstständig organisiert und erweitert, um die Anwendung lernfähig zu machen. Mit jeder neuen Messung arbeitet die Apparatur dadurch immer präziser. Bei der Konstruktion und Zusammenführung der einzelnen Anlagenmodule geht es insbesondere darum, die Geschwindigkeit und das Zusammenspiel der Einzelkomponenten weiter so zu optimieren, dass die in der Praxis erforderlichen Durchsatzquoten erreicht werden und sich die Lösung nahtlos in die Abläufe der Brütereien eingliedert.
Weiteres Verfahren in Großenkneten vorgestellt
Am 6. Juli 2017 stellten Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, Prof. Dr.
Almuth Einspanier von der Universität Leipzig und Dr. Ludger Breloh von der Rewe Group
erstmals in einer Brüterei in Großenkneten, Landkreis Oldenburg, der breiten Öffentlichkeit
das endokrinologische Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei vor. Dabei wird
dem Ei mittels einer feinen Injektionsnadel Flüssigkeit entnommen, anhand derer mit einem
Marker das Geschlecht des künftigen Kükens bestimmt werden kann. In aktuellen
Versuchsreihen mit dem ersten Prototypen liegt die Genauigkeit der Geschlechtsbestimmung bereits sehr hoch und erreicht mindestens die in der Praxis geforderten 95 %. Das endokrinologische Verfahren hat somit das Potenzial, in den nächsten Jahren die Praxis des Tötens von männlichen Legehennenküken zu überwinden.
"Ich freue mich sehr, dass wir in Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen und unserem
Ziel, das Töten männlicher Küken zu beenden, einen entscheidenden Schritt näher kommen", erklärte Schmidt in Großenkneten.
Hohe Sicherheit bereits im Versuchsstadium
Einspanier von der Universität Leipzig beschreibt: "Wir entnehmen dem befruchteten Brutei eine minimale Menge des embryonalen Harns am achten bis zehnten Bruttag, also noch bevor ein mögliches embryonales Schmerzempfinden entsteht. Mithilfe eines Markers gehen wir dann auf die Suche nach einem bestimmen Hormon. Weisen wir dieses nach, so entwickelt sich ein weibliches Küken. Fehlt dieses Hormon, dann wird es ein männliches Küken, das nicht weiter ausgebrütet wird. Die weiblichen Küken schlüpfen ohne Probleme. Wir haben also mit der Geschlechtsbestimmung im Ei ein Verfahren, das einerseits bereits im Versuchsstadium eine sehr hohe Sicherheit in der Bestimmung bietet und andererseits die weitere Entwicklung der Embryos zum Küken nicht beeinflusst.“
Jedoch ist es noch ein weiter Weg bis zur Praxisreife: Die größte Hürde darin besteht, die
Arbeitsgeschwindigkeit und den Beprobungserfolg des Prototypen zu erhöhen. Aktuell können nur einige Eier pro Stunde untersucht werden. Bei 100 Millionen Eiern, die in Deutschland pro Jahr bestimmt werden müssten, ist das zu langsam.


